Hier finden Sie eine Auswahl von Fachartikeln von verschiedenen Themen
Beschaffung
Die „Machenschaften“ der Fahrzeughersteller – wie man in den Markt hineinruft... Jetzt rufen Fuhrparkbetreiber eben auch Aufträge zurück.
(Axel Schäfer, Zeitschrift bfp – Fuhrpark & Management 04/2022)
Fuhrparkverantwortliche haben es derzeit nicht leicht: erst kam Corona, dann die Halbleiterkrise und jetzt gibt es einen Hochlauf an Rückrufaktionen. Was bedeutet das für das Fuhrparkmanagement
Kennen Sie Menschen, die gerne bestimmte Worte vermeiden, weil sie ihnen unangenehm sind? Da nennt man die Sache einfach um. Und schon tut man etwas Gutes. Beispiel „GEZ“. Da werden jetzt keine Gebühren mehr eingezogen, sondern ein Beitragsservice geboten. Eine Heerschar von Marketingleuten hat sich offensichtlich etwas einfallen lassen, was besser klingt. Und in der Folge leichter verdaut, besser akzeptiert wird – und vor allem gut für das Image ist. So wird Outplacement zu Newplacement, die Zusatzsteuer heißt Solidaritätszuschlag und und und. Es kommt eben manchmal auf die Perspektive an.
Auch bei Fehlern oder Serienmängeln an Fahrzeugen – ein ernst zu nehmendes Thema für alle Fuhrparkverantwortlichen – wird nicht immer mit offenen Karten gespielt. Fehler passieren nun mal. Doch statt das zuzugeben und einen für die Nutzenden kostenneutralen Rückruf zu organisieren, werden von einigen Herstellern einfach unter dem Deckmantel „Service“-Aktionen und „qualitätsverbessernde Maßnahmen“ angeboten. Hört sich auch besser an, denn bei einem Rückruf würde jeder wissen, dass es ein Produktionsfehler war. Nun, vielleicht war in dem ein oder anderen Fall tatsächlich die meist prozentual definierte Voraussetzung für einen Serienfehler nicht gegeben. Aber schlafende Hunde sollen ja auch nicht geweckt werden.
Fuhrparkverantwortliche als Versuchskaninchen
Rückrufe sind nichts Neues, allerdings in diesem Ausmaß doch ungewöhnlich. Allein im November 2021 wurden rund 240.000 Mercedes-Fahrzeuge in Deutschland aufgrund eines technischen Defekts zurückgerufen und Opel hatte im Februar 2022 ein Problem, bei dem etwa 110.000 Fahrzeuge betroffen waren. Und täglich verzeichnet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) neue Rückrufaktionen. In einer Studie des Center of Automotive Managements (CAM) gibt der Institutsleiter Stefan Bratzel an, dass die hohen Rückrufquoten vor allem auf den Veränderungsdruck in der Branche zurückzuführen sind. Um mitzuhalten, müssen Hersteller schnell Neues auf den Markt bringen, weshalb die Fahrzeuge oft unfertig sind und die Käufer:innen dann als Versuchskaninchen herhalten müssen. Hinzukommen laut CAM außerdem Effekte der Gleichteilestrategie. Fehlerhafte Komponenten werden nicht mehr nur in einem Modell verbaut, sondern in einer ganzen Modellfamilie. Kommt es zu einem Problem mit einem Bauteil sind dementsprechend viel mehr Fahrzeuge – auch herstellerübergreifend – betroffen, denn die Entwicklung der Teile wird auf Zulieferer verlagert und die gleichen Teile bei verschiedenen Herstellern verbaut. Aber sind wir mal ehrlich, das ist auch keine Entschuldigung für hunderttausende zurückgerufene Fahrzeuge. Wer für Qualität steht, muss auch Qualität liefern.
Die Gründe für die als „Service“-Aktion getarnten Rückrufe sind vielfältig – mal gibt es einen Defekt am Ladekabel, mal sind es Probleme am Airbag und in einem anderen Fall gibt es ein Problem am Motor-Steuergerät. So unterschiedlich die Gründe sind, so verschieden sind auch die Folgen: von Brandgefahr bis hin zu einem plötzlichen Ausfall des Motors ist alles dabei. Den Schadensmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – ebenso auch den Reaktionen der Hersteller. Im besten Fall bekommt man ein Schreiben, das einen über die Mängel informiert und gleichzeitig darlegt, dass die Ersatzteile derzeit nicht verfügbar sind, weshalb das Fahrzeug nicht repariert werden kann. Flottenverantwortliche befinden sich dann in einer Zwickmühle. Sie sind auf das Fahrzeug angewiesen, müssen aber auch den Fürsorgepflichten gegenüber den Mitarbeitenden nachkommen. Laut Arbeitsrecht und der DGUV-Vorschrift 70 dürfen Fuhrparkverantwortliche ihren Mitarbeitenden kein Arbeitsmittel an die Hand geben, das eine Gefahr darstellt. Außerdem müssen Halterhaftung und Halterpflichten beachtet werden. Nach Paragraph 23 Absatz 2 der Straßenverkehrs-Ordnung darf ein Fahrzeug nur in Betrieb genommen beziehungsweise gegeben werden, wenn es vorschriftsmäßig ist. Die Warnung alleine führt zwar noch nicht dazu, dass die Betriebserlaubnis erlischt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann handelt es sich um einen Graubereich. Mit gutem Gewissen kann man die Mitarbeitenden nicht in ein mangelhaftes Fahrzeug lassen.
Folgen für Fuhrparkmanager:innen
Viele Mitglieder des Verbandes haben im vergangenen Jahr ein Rückrufschreiben erhalten mit dem Hinweis, das betroffene Fahrzeug möglichst umsichtig zu fahren und die Nutzung auf ein Minimum zu reduzieren. Die Hersteller sind damit aus der Verantwortung, sie haben ja auf die Gefahr hingewiesen. Was das letztendlich für Fuhrparkverantwortliche bedeutet, daran denkt keiner. Einen kostenneutralen Rückruf gibt es nämlich nicht. Es gibt nicht einmal eine rechtliche Verpflichtung seitens der Hersteller zur Übernahme der Reparaturkosten oder für einen Leihwagen während des Ausfalls. Die Reparaturkosten können, wenn überhaupt, nur innerhalb der Sachmängelhaftungsfrist oder im Rahmen einer Garantie geltend gemacht werden. Und selbst wenn die Kosten aus Angst vor einem Imageverlust übernommen werden, ist es damit nicht getan. Qualitative Mängel sind nicht nur ärgerlich, sie kosten Geld und Zeit. Je nach Fuhrparkgröße kommt eine fünfstellige Eurosumme zusammen, wenn man nur 1 ½ Stunden Aufwand pro Fahrzeug mit Qualitätsmängeln zu Grunde legt. Die Nachbesserung in der Werkstatt bedeutet Zeiteinsatz, Prozesskosten und Mobilitätsausfall. Dieser ist nicht nur mit einem administrativen Aufwand verbunden, sondern bringt auch Kosten mit sich – vor allem dann, wenn man für ein Ersatzfahrzeug sorgen muss. Und wenn das Fahrzeug aufgrund von Teilemangel nicht direkt repariert werden kann, dann können aus ein paar Stunden schnell Wochen oder sogar Monate werden.
Aber eins möchte ich bei aller Kritik noch betonen: Besser zurückrufen und nachbessern, als nichts zu tun, wie es uns bei Tesla aufgefallen ist. Beispielsweise sind nach den geltenden Unfallverhütungs-Vorschriften Verzurrösen im Kofferraum erforderlich, bei Tesla aber nicht erhältlich. Eine ordnungsgemäße Ladungssicherung ist damit nicht möglich. Manche Fuhrparkbetreiber improvisieren und ordnen an, dass die Rückbank nicht umgeklappt werden darf, um Dinge zu transportieren. Das kann ja aber nicht Sinn der Sache sein. Das geht so weit, dass mehr und mehr Firmenkunden die Beschaffung von Fahrzeugen der Marke Tesla sperren. Aktuell fiel außerdem auf, das Tesla aus Kostengründen auf Felgenschlösser verzichtet hat. Leichte Beute für Kriminelle, großes Risiko für Flottenverantwortliche. Dieses eigentlich selbstverständliche Sicherheitsdetail muss aktiv nachgerüstet werden.
Wir als Verband fordern, dass Hersteller bei Rückrufen und Serienmängeln für den entstandenen Abwicklungsaufwand seitens der Fuhrparkverantwortlichen aufkommen. Letztendlich müssen sich Fahrzeughersteller Gedanken machen, wie sie mit Fuhrparkkunden umgehen, damit diese nicht am Ende ihre Aufträge zurückrufen. Fuhrparkverantwortlichen sind immerhin eine große Kundengruppe beim Fahrzeugkauf, mit ihnen sollte man sich gut stellen. Rückrufaktionen sind allemal ein Thema, um das wir uns im Auftrag unserer Mitglieder in diesem Jahr besonders kümmern werden.
Zitat Axel Schäfer: Fehler können passieren. Aber Hersteller sollten dringend über kundenorientiertere Prozesse bei Rückrufen nachdenken – und es nicht beim Denken belassen..

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Zeitschrift bfp – Fuhrpark & Management 04 / 2022
Digitaliserung

(Axel Schäfer, Artikel für die Zeitschrift Flottenmanagement - Ausgabe April 2023)
Spätestens mit der Coronapandemie wurde klar, dass der Digitalisierung im Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement eine immer größere Bedeutung zukommt. Digitale Prozesse und Systeme sind im Alltag der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche angekommen und helfen bei der Erreichung verschiedener Ziele. Die Möglichkeiten sind vielfältig, werden aber längst noch nicht flächendeckend genutzt. Dabei kann die Digitalisierung einen erheblichen Beitrag zur Mobilitätswende leisten.
Wenngleich die letzten Jahre viele Krisen hervorgerufen haben, hatte die Pandemie auch etwas Gutes: die Beschleunigung der Digitalisierung. Neue Arbeitsformen erforderten neue Lösungen und die Zeit der Online-Meetings erlebte einen regelrechten Boom. Auch wenn digitalisierte Prozesse schon vor der Pandemie vorhanden waren, schien man sie erst durch die Pandemie schätzen zu lernen. Es offenbarten sich aber auch Lücken und Unwägbarkeiten. Dies ermöglicht die Weiterentwicklung und Verbesserung von Digitalisierungslösungen.
Möglichkeiten für das Fuhrparkmanagement
Für das eigentliche Fuhrparkmanagement reicht das Spektrum von neuen technischen Möglichkeiten bei Fahrzeugen, wie Assistenzsystemen, Telematik und autonomes Fahren. Letzteres wird noch einige Zeit brauchen, kann aber erhebliche Bedeutung gewinnen. Telematikbasierte Versicherungstarife sind seit einiger Zeit möglich und auch Systeme für ein intelligentes Flottenmanagement werden weiterentwickelt. Bekannte Tools, wie zum Beispiel elektronische Fahrtenbücher, sind hierbei eher schon „Oldies“, haben aber immer noch Potenzial. Spannend wird es bei Management-Systemen, beispielsweise im Poolfahrzeugmanagement. Hier ist die Zukunftsaufgabe vor allem auch elektrisierte Flotten steuern zu können. Die digitale Verwaltung der Fahrzeuge vereinfacht Analysen von Auslastung und Fahrprofilen des Fahrzeugpools. So entsteht eine Datengrundlage, mit der die tatsächlich benötigte Fahrzeuganzahl überprüft und bedarfsgerecht angepasst werden kann.
Digitales Schaden- und Reparaturmanagement ist ein weiterer Baustein im Konzept der digitalisierten Welt. Neben dem Schadenmanagement kann auch das Risikomanagement durch Digitalisierung im Vorfeld transparenter werden, um auf lange Sicht Kosten zu vermeiden. Selbstredend können Poolfahrzeuge entsprechend mit Buchungssystemen gemanagt werden.
Häufig scheuen Unternehmen den Aufwand einer Digitalisierung. Dies ist aber meist zu kurzsichtig, denn mit einer stärkeren Digitalisierung können Prozesse verbessert werden, Einsparungseffekte erzielt und vor allem die inzwischen unabdingbaren Nachhaltigkeitsaspekte verbessert werden.
Eine erhebliche Zeitersparnis ist im Schaden- und Wartungsmanagements möglich, denn dies nimmt einen großen Anteil in der täglichen Arbeit der Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen ein. Das digitale Schadenmanagement wird nicht nur vorangetrieben, weil die Digitalisierung in den letzten Jahren einen Schub bekommen hat. Auch die Interkonnektivität der Fahrzeuge ist ein Treiber der Entwicklung. Ein vernetztes Auto kann bei einem Auffahrunfall automatisch das Servicecenter des zuständigen Versicherers alarmieren oder auf drohende Schäden hinweisen. Flottenmanagementsysteme visualisieren außerdem Servicebedarfe, die Schadenakte und den Reparaturstatus von Fahrzeugen. Zudem können Reifenwechsel, Reinigung oder Reparaturen digital ausgelöst werden. Auch weitere Prozessschritte wie Terminierung und Kommunikation mit der Werkstatt können digital abgebildet werden.
Fuhrparkmanagement genügt nicht mehr
Es wird aber immer deutlicher, dass die Beschränkung auf ein reines Fuhrparkmanagement auch unter Einbeziehung einer stärkeren Digitalisierung nicht ausreichen wird. Mobilität wird vielfältiger. Die Elektrifizierung von Flotten ist nicht aufzuhalten. Es geht immer nach der Devise: Das Machbare tun und das Zukünftige anstreben. Betrachtet man die betriebliche Mitarbeitermobilität als Ganzes fällt rasch auf, dass ein Mobilitätsmanagement der Zukunft nur digital erfolgen kann. Das Spektrum der betrieblichen Mitarbeitermobilität reicht von Arbeitswegen über die Dienstradnutzung, die Einbindung des ÖPNV und der Dienstreisemittel bis hin zu Fahrzeugen. Es gilt also Systeme intelligent zusammenzuführen und so zu entwickeln, dass die Anwendbarkeit auch für Mitarbeitende und deren erforderliche Mobilität gewährleistet bleibt. Systeme, die zu komplex sind und nicht nahtlos nutzbar, verstärken gegebenenfalls die Ablehnung und damit wäre eine Digitalisierung kontraproduktiv. Zudem müssen Systeme eine Steuerung und ein Controlling des Gesamtgeschehens ermöglichen und hier haben wir heute, zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität, erhebliche Defizite. Verbrauchsbezogene Analysen sind teils nur mit großem Aufwand möglich, da kein Ladesäulenbetreiber auf die Idee kam, Kilometerstände zu erfassen.
Digitalisierung unterstützt Mobilitätswende
Im Rahmen einer zielgerichteten Digitalisierung bieten sich nicht nur direkte Vorteile für Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche wie Verringerung des administrativen Aufwands, Zeitersparnis und Kostensenkung. Entsprechende Systeme können auch dabei unterstützen, den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens zu reduzieren.
Die Digitalisierung wird und kann Auswirkungen auf die gesamte betriebliche Mobilität haben. Das Stichwort Mitarbeitermobilität spielt schließlich auch eine tragende Rolle. Die Digitalisierung verbessert die Nutzbarkeit umweltfreundlicher Mobilitätsangebote, denn Apps und Smartphones bieten einen ständig verfügbaren Zugang zu Routenplanungen und Buchung für Tickets im ÖPNV. Zudem ist es sinnvoll auch einmal über den Tellerrand der eigenen Unternehmensmobilität hinauszuschauen. Im Bereich Verkehrssteuerung sind ebenfalls erhebliche Digitalisierungsmaßnahmen im Gang. Die Nutzung entsprechender Daten für die eigene betriebliche Mobilität ist naheliegend. Bessere Verkehrs- und Routenplanungen können ebenfalls Einsparungen mit sich bringen und tragen zu einer größeren Nachhaltigkeit bei.
Daten sind das Gold der Zukunft – Datenschutz muss gewahrt bleiben
Auch wenn die Vorteile der Digitalisierung auf der Hand liegen, sind mit der Zunahme von digitalen Prozessen bei der betrieblichen Mobilität auch Herausforderungen verbunden. Wissen zum Thema Daten und Datenschutz ist unabdingbar. Verantwortliche müssen sich mit Programmen vertraut machen, um einen richtigen Umgang mit Daten zu gewährleisten. Und der Streit, wem Daten gehören und wer welche Daten nutzen darf, ist schon in vollem Gange. Wichtig ist sich an die Regeln zu halten, die die Datenschutz-Grundverordnung vorgibt. Dazu gehört auch zwingend die Einwilligung der Betroffenen einzuholen, bevor Daten erhoben und verarbeitet werden. Geschieht die Einwilligung nicht, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich verboten.
Fazit: Der Stand der Digitalisierung bei der betrieblichen Mobilität ist je nach Unternehmen und Anwendungsfall verschieden. All diejenigen, die glauben, ein „weiter so“ ist machbar, werden zeitnah merken, dass dies beachtliche Probleme mit sich bringen kann. Fehlende digital gemanagte Mobilitätskonzepte können zu einem Wettbewerbsnachteil werden. Es gilt die Augen offen zu halten und offen zu sein für Innovationen. Dies alles aber in einer für Menschen verträglichen Taktung. Der gewaltigen Aufgabe Mobilität effizient, zielgerichtet und nachhaltig zu vernünftigen Konditionen anzubieten, wird eine weitere hinzugefügt: Die Mitarbeitenden müssen zwingend in diesem Prozess einbezogen und vor allem mitgenommen werden. Denn sie sind es, die letztlich neue Konzepte leben und in Ihren Alltag integrieren müssen. Fuhrparkmanagement ist im Kontext betrieblicher Mobilität keine isolierte Aufgabe mehr. Es gilt interdisziplinäre Teams zu bilden, die die eigene betriebliche Mobilität entwickeln. Dies ist dann vor allem eine Führungsaufgabe auf der oberen Ebene. „Läuft nebenbei mit“ wird nicht mehr funktionieren.

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt in den Bereichen Mobilitäts-, Fuhrparkmanagement und Leasing. Er publiziert zu den Themen regelmäßig Beiträge in Büchern, Fachmagazinen und ist immer wieder Redner bei Vorträgen im Rahmen verschiedener Events, Seminare und Workshops.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement (Ausgabe April 2023)

(Axel Schäfer, Zeitschrift Flottenmanagement 03/2022)
Seit dem 1. Januar 2021 besteht die Pflicht für alle neuen Fahrzeuge, dass sie mit einer Überwachungseinrichtung für den Kraftstoff- beziehungsweise Stromverbrauch ausgestattet sind. Dieses sogenannte On-Board Fuel Consumption Monitoring (OBFCM) speichert die Daten zum realen Kraftstoff- oder Stromverbrauch über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs hinweg, um Abweichungen feststellen zu können. Der Datenschutz darf dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden.
Bei OBFCM handelt es sich um eine fahrzeuginterne Überwachungseinrichtung beziehungsweise ein Verbrauchsmessgerät, das die realen Verbrauchswerte eines Fahrzeugs erfassen soll. Sie dient dem Gesetzgeber dazu, Abweichungen zwischen den Laborwerten und den Verbrauchswerten im tatsächlichen Fahrbetrieb festzustellen. Somit kann die Lücke zwischen Prüfstandsmessungen und Realemissionen verringert werden und noch realistischere Verbrauchsangaben für die Fahrzeughalter sind möglich. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren wird der Kraftstoffverbrauch ermittelt, bei Plug-in-Hybriden zusätzlich der Verbrauch an elektrischer Energie.
Grundlage der OBCFM ist die EU-Verordnung 2017/11511 nach der Automobilhersteller dafür sorgen müssen, dass Pkw ab dem 1. Januar 2021 mit dieser Überwachungseinrichtung ausgestattet sind. Bis 2026 ist die Regelung als Erprobungsphase angelegt, spätestens 2030 muss die EU-Kommission dann ein Gesetz formulieren, damit die Diskrepanzen minimiert und die Hersteller sanktioniert werden können, wenn die Lücken zwischen Laborwerten und Realverbräuchen zu groß sind. Aktuell gilt die Verordnung nur für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sowie für Plug-in-Hybride, die mit Diesel, Biodiesel, Benzin oder Ethanol betrieben werden. Reine Elektrofahrzeuge sowie Fahrzeuge, die mit Bio- oder Erdgas (CNG) oder Flüssiggas (LPG) betrieben werden, sind derzeit noch von der Verordnung ausgenommen. Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 gibt Auskunft darüber, ob das Fahrzeug die Überwachung unterstützt. Entscheidend dafür ist die Emissionsschlüsselnummer „36AP“ im Feld 14.1. Dort muss das Kürzel „FCM“ stehen, was „Fuel Consumption Monitoring System“ bedeutet.
Auslesen der Daten
Das verpflichtende Auslesen der Daten kann entweder durch eine direkte Übertragung aus dem Fahrzeug per Mobilfunk erfolgen, also over-the-air, oder durch Vertragshändler und Vertragswerkstätten bei jeder Wartung oder Reparatur. Geplant ist, dass ab dem 20. Mai 2023 die Datenerhebung und -übermittlung auch im Rahmen der Hauptuntersuchung (HU) erfolgen soll.
Aufgezeichnet und gespeichert werden der Kraftstoffverbrauch, die zurückgelegte Strecke, die Fahrzeuggeschwindigkeit und der Kraftstoffdurchsatz des Motors und des Fahrzeugs. Bei Plug-in-Hybriden werden unter anderem zusätzlich folgende Daten benötigt: der Kraftstoffverbrauch insgesamt im Betrieb bei Entladung, die zurückgelegte Strecke insgesamt im Betrieb bei Entladung bei abgeschaltetem Verbrennungsmotor und die der Batterie zugeführte Netzenergie.
Meldepflicht der Daten
Seit 2022 sind die Fahrzeughersteller dazu verpflichtet, der EU-Kommission jedes Jahr zum 1. April die im Vorjahr erhobenen OBFCM-Daten inklusive der Fahrzeugidentifikationsnummer zu melden. Eine Speicherung der Daten erfolgt im Datenspeicher der Europäischen Umweltagentur EEA (European Environment Agency). Auf Grundlage von Stichproben müssen die Typgenehmigungsbehörden (beispielsweise das Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland) prüfen, ob die in den Übereinstimmungsbescheinigungen angegebenen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte, mit denen von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen übereinstimmen. Zukünftig sollen dabei auch die OBFCM-Daten berücksichtigt werden. Tritt eine Abweichung auf, sind die Typgenehmigungsbehörden dazu verpflichtet, diese unverzüglich der EU-Kommission zu melden.
Die EU-Kommission nutzt die Daten zur Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers und prüft, ob die Zielvorgaben überschritten werden. Geplant ist, dass ab Dezember 2022 außerdem anonymisierte OBFCM -Datensätze zu den einzelnen Fahrzeugmodellen durch die EU-Kommission veröffentlicht werden. Das soll Verbraucher zu klimafreundlichen Kaufentscheidungen bringen.
Die Fahrzeugidentifikationsnummer unterliegt dem besonderen Schutz der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), weshalb es den Fahrzeughaltern eingeräumt wurde, einer solchen Datenerhebung beziehungsweise -übermittlung zu widersprechen. Allerdings fehlen zum jetzigen Zeitpunkt noch klare Prozesse, wie dieser Widerspruch zu erfolgen hat.
Datenschutz beachten
Der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. begrüßt ebenso wie der ADAC die neuen Vorschriften, die die Lücke zwischen Laborwerten und dem Realverbrauch schließen soll. Das ist eine Erleichterung für das Fuhrparkmanagement, wenn die angegebenen Laborwerte zum Kraftstoff- und Stromverbrauch eher den Realwerten entsprechen. Allerdings sehen auch wir als Verband noch weiteren Handlungsbedarf. An oberster Stelle muss der Datenschutz stehen, damit das System nicht zu gläsernen Autofahrer:innen führt. Die Kfz-Verbrauchsdaten müssen so verschlüsselt sein, dass sie weder durch Hersteller noch von Dritten manipuliert werden können. Der ADAC fordert außerdem, dass die im OBFCM erfassten Daten in plausible Beziehungen zu individuellem Fahrverhalten, der Außentemperatur und dem Streckenprofil im realen Fahrbetrieb gesetzt werden. Das halten auch wir für sinnvoll, um die Repräsentativität der CO2-Emissionen zu gewährleisten und die Unregelmäßigkeiten aufzudecken. Außerdem sind zum jetzigen Zeitpunkt reine Elektrofahrzeuge sowie gasbetriebene Fahrzeuge von der Pflicht ausgenommen. Auch diese weisen teilweise erhebliche Abweichungen zwischen den Laborwerten und den tatsächlichen Verbrauchswerten auf, weshalb auch hier eine Pflicht zur Messung der OBVFM-Daten sinnvoll wäre.
Eine Überwachungseinrichtung für den Strom- und Kraftstoffverbrauch kann das Management von Fuhrparks vereinfachen, wenn es richtig genutzt wird. Durch die Minimierung der Diskrepanzen kann der tatsächliche Verbrauch im Voraus besser geplant werden. Allerdings besteht noch Handlungsbedarf und es muss gewährleistet sein, dass die Daten nicht missbraucht und nur anonymisiert übermittelt werden.

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement Ausgabe 03/2022

(Axel Schäfer, Zeitschrift Flottenmanagement 01/2021)
Knapp 30 Prozent des Arbeitstages eines Fuhrparkmanagers werden von der Schadenabwicklung in Anspruch genommen. Wie können digitale Lösungen die lange Prozesskette im Schadenmanagement automatisieren und optimieren?
Durch die Pandemie gab es weniger Kilometer zu fahren, ein geringeres Verkehrsaufkommen und tatsächlich weniger Unfälle, so die Statistik. Die Zahlen sind gesunken, gehen aber noch immer in die Millionen. Keine Frage, das Schadenmanagement ist und bleibt ein Dauerbrenner bei den Fuhrparkverantwortlichen. Und nicht nur bei Meetings, Messen und Schulungen hat die Digitalisierung einen Schub bekommen. Seit vielen Jahren ist die Steigerung des Automatisierungsgrades und die digitale Transformation auch bei der Schadenabwicklung ein Thema. Und nie war es notwendiger, Kontaktpunkte zu minimieren.
Die Interkonnektivität der Fahrzeuge ist der zweite große Treiber dieser Entwicklung: Ein vernetztes Auto kann bei einem Auffahrunfall automatisch das Servicecenter des zuständigen Versicherers alarmieren oder auf drohende Schäden hinweisen. Die systematische Optimierung des Schadenmanagements unter Einsatz digitaler Technologien ist nicht nur prozessual entlastend, sondern kann auch je nach Fuhrpark drei bis fünf Prozent der Gesamtkosten einsparen. Laut Experten spielt dabei in den letzten Jahren vor allem die Reduzierung der Versicherungsprämien eine immer größere Rolle.
Die Komplexität des Schadenmanagements ist jedoch nicht zu unterschätzen: Eine Vielzahl von möglicher Schäden - vom Steinschlag bis zum Vandalismus – ist in der typischerweise kommunikationsintensiven, von vielen Partnern bestimmten Prozesskette zu bewältigen.
Pandemie – Einmaleffekt oder Game Changer?
Die Pandemie bescherte den Fuhrparks ungeplante Kosteneinsparungen: So sank im ersten Halbjahr 2020 ausnahmslos über alle Schadensursachen die Fallanzahl – in der Summe um rund 19 Prozent. Nicht verschweigen darf man aber den Beitrag der guten Wetterlage in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres.
Die Fuhrparkbetreiber können sich jedoch nicht wirklich darüber freuen, da der durchschnittliche Aufwand je Schaden weiterhin einem steigenden Trend folgt – im ersten Halbjahr 2020 um fünf Prozent. Als sicher kann auch gelten, dass nach der Pandemie die Schäden wieder zunehmen: In „normalen“ Zeiten haben Fuhrparks in Deutschland alle zwölf Sekunden einen Unfall, gut alle 90 Sekunden einen Einbruchdiebstahl und alle 120 Sekunden einen Brandschaden zu bearbeiten.
Nicht so schnell verändern dürfte sich die neue Einstellung der Menschen zur individuellen Fortbewegung: In einer Befragung des Research-Unternehmens Ipsos äußern fast 80 Prozent der Teilnehmer, dass sie aufgrund der Pandemie die Sicherheit des eigenen Fahrzeugs deutlicher wahrnehmen. Das Automobil kann ein neues wichtiges Qualitätsmerkmal gegenüber den Massenfortbewegungsmittel in Anspruch nehmen.
Anwendungen
Unspektakulär, aber hilfreich sind Flottenmanagementsysteme, die Servicebedarfe, Schadenakte und Reparaturstatus von Fahrzeugen visualisieren. Reifenwechsel, Reinigung oder Reparaturen – alles das sollte digital auch ausgelöst werden können. Signifikanten Einfluss auf die Kosten hat insbesondere die intelligente Steuerung von verunfallten Fahrzeugen in ein Werkstattnetz. Wichtig ist hier, dass das Netzwerk frei und nach den Wünschen der Flotte zusammengestellt werden kann. Nur so ist es möglich den wachsenden Reparatur-Anforderungen gerecht zu werden.
Aus Fahrersicht hat die unkomplizierte Schadenmeldung erste Priorität. Aber es darf nicht nur um die Meldung an sich gehen, ebenso sollten die weiteren Prozessschritte wie Terminierung und Kommunikation mit der Werkstatt beispielsweise zum Thema Leihwagen oder Hol- und Bringdienst digital abgebildet werden. In einer digitalen Schadenmanagement-Welt kann diese über eine App abgewickelt werden. Viele Anbieter ermöglichen dies sogar im Corporate Design des Kunden und haben ihre Anwendungen auch mit Funktionen für akute Notsituationen wie Bergungs- und Rettungseinsätze ausgestattet. Sicherheitsmechanismen wie eine wirksame Verschlüsselung oder die Multi-Faktor-Authentifizierung vervollkommnen eine digitale Schadenmanagementlösung. Aber auch eine Hotline ist neben einer App sinnvoll, denn es gibt Fälle, da hilft die rein digitale Meldung nicht wirklich weiter. Da Schadenmanagement immer eine Gemeinschaftsleistung vieler Dienstleister und Partner ist, sollte besondere Aufmerksamkeit auf die Schnittstellen gelegt werden. Um einen wirklich guten und effizienten Prozess zu ermöglichen, ist es nicht nur relevant, dass der Dienstleister die entsprechenden Schnittstellen zu Partnern anbietet, um Daten zu übertragen. Es sollte möglich sein, wirklich miteinander zu kommunizieren und Prozessschritte digital anstoßen zu können, wie Freigaben, Rechnungsprüfungen et cetera.
Die Live-Stream-Begutachtung von Schäden – meist per Tablet oder Smartphone eventuell unterstützt durch ein Lackschichtdickenmessgerät und Hilfsmittel zur Schadenmarkierung - hat sich bewährt. Lediglich gute Lichtverhältnisse und eine stabile Verbindungsqualität sind zu gewährleisten. Von Mitarbeitern wird die Live-Stream-Begutachtung geschätzt, da sie kontaktlos ist und ohne Anfahrtszeit auskommt. Auf Basis dieser Daten erstellen die Systeme und Portale dann schon eine erste Kostenprognose.
Bei Großschadenereignissen ermöglicht die durch Künstliche Intelligenz gestützte Bilderkennung schon heute beeindruckende Leistungen. Auch bei Bagatellschäden kann das besonders interessant sein, da in diesem Fall schnell entschieden werden kann, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt oder nicht. Es gibt mobile Anlage zur automatisierten Bewertung von Fahrzeugen vor Rücknahme und Rückgabe. Beschädigte Fahrzeuge werden in einen Scanner-Tunnel gefahren, der die Karosserie mittels Kameras in weniger als einer Minute auf Farbbild, Oberflächenkrümmung und Reflektivität untersucht und eine Schadensbewertung abgibt. Zum Vergleich: Sachverständige benötigen bis zu 30 Minuten für die aufwendige Zählung und Evaluation von Schäden (zum Beispiel Hagelereignissen).
Ein umfassendes digitales Schadenmanagement wird mit einem transparenten Reporting abgerundet. Eine Auswertungskontrolle auf Einzelschaden- und Gesamtschadenbasis mit Echt-Zeit-Zugriff und individuellen Filtermöglichkeiten sind Branchenstandard
Ein Bremsklotz im digitalen Schadenmanagement ist aktuell noch die recht analoge Kommunikation mit den Versicherern. Viele Kundendaten sind bei den Assekuranzen weiterhin nicht digital erfasst, auch wenn das elektronische Zulassungssystem in Deutschland neue Möglichkeiten schafft.
Wissen ist der Schlüssel
Transparenz und Wissen um die Kosten, die Schäden ausmachen, um den betriebenen Aufwand und die Schaden-Ursachen sind der Schlüssel dazu, das Thema im Griff zu haben. Dann kann gegengesteuert oder nach neuen Lösungen gesucht werden, die der Markt und viele Anbieter inzwischen bieten. Kosten zu sparen, weniger Zeit mit einzelnen Fällen zuzubringen und durch Fahrertrainings oder Assistenzsysteme die Schäden weiter zu reduzieren, muss das Ziel sein. Und das funktioniert auch bei dem kleinsten Fuhrpark nicht analog. Gerade die Digitalisierung hilft, diese Komplexität zu reduzieren und Schadenmanagement wesentlich zugänglicher zu gestalten.
Weitere Informationen: www.mobilitaetsverband.de
Generischer Schadenmanagement-Prozess


Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement Ausgabe 01/2021
Elektromobilität

(Marc-Oliver Prinzing, Zeitschrift Flottenmanagement - Ausgabe Dezember 2022)
Die Aussichten für die Elektrifizierung in Fuhrparks sind ungewiss. Lieferengpässe bremsen die Mobilitätswende und die Auslieferung von Elektroautos. Gleichzeitig gibt es ein Ende der Förderungen – zumindest was die gewerblichen Fahrzeuge angeht. Ab dem 1. September 2023 sollen diese nicht mehr bezuschusst werden. Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche stellen sich derzeit deswegen zu Recht die Frage, ob sich Elektrofahrzeuge im Fuhrpark noch lohnen.
Um den Hochlauf der Elektromobilität zu beschleunigen, wurde auf politischer Seite ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Dazu wurde unter anderem der sogenannte Umweltbonus ins Leben gerufen, um die deutlich höheren Kosten für Elektroautos zu kompensieren. Ergänzt um die in der Coronapandemie initiierte Innovationsprämie und den Herstellerzuschuss kamen so am Ende bis zu 9.000 Euro je Elektrofahrzeug-Kauf zusammen. Zusätzlich wurden Plug-in-Hybride als nachhaltig erklärt, egal, wie sie genutzt werden, und mit einer Prämie von bis zu 6.750 Euro bezuschusst. Diese Förderung war allerdings noch nie sinnvoll, da sie nicht an eine Mindestnutzung des Elektroantriebs geknüpft war. Der tatsächliche Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen dürfte bei Plug-in-Hybriden also eher gering ausfallen. Bezüglich der reinelektrischen Fahrzeuge waren die Fördermaßnahmen aber durchaus richtig und wichtig, um Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche auf alternative Antriebe aufmerksam zu machen und die Elektrifizierung zu fördern.
Die Bundesregierung hat nun allerdings in einem überarbeiteten Maßnahmenpaket beschlossen, die Förderungen weitestgehend zu stoppen. Plug-in-Hybride fallen künftig komplett aus der Förderung und ab dem 1. September 2023 werden keine rein elektrischen Fahrzeuge mehr gefördert, sofern es sich um gewerbliche Zulassungen handelt. Die enorm langen Lieferzeiten kombiniert mit der Regelung der Regierung, dass der Zulassungszeitpunkt und nicht die Bestellung entscheidend für die Zuwendung ist, führen dazu, dass fest einkalkulierte Förderbeträge für bereits bestellte Fahrzeuge in Unternehmen entfallen. Genau genommen können Unternehmen davon ausgehen, dass auch bei einer Lieferung vor dem Stichtag der limitierte Fördertopf leer sein wird. Für 2023 steht dank der Deckelung lediglich eine Summe von 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Nicht wenig, wie es im ersten Moment erscheint, doch für den Zweck zu wenig und eigentlich bald ausgeschöpft.
Auswirkungen auf Unternehmen
Was bedeutet das alles für Unternehmen, die gerade auf Elektromobilität umstellen? In erster Linie stellt sich bei dieser Entscheidung die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Rechnen sich Elektroautos noch oder wird das Ganze zu einem massiven Verlustgeschäft gegenüber der Anschaffung eines klassischen Verbrenners? Die Antwort ist nicht ganz so einfach. Zunächst muss festgestellt werden, dass Elektroautos nach wie vor teurer in der Anschaffung – und in Folge auch im Leasing – im Vergleich zu Verbrennern sind. Entgegen der seit Jahren beschworenen Skaleneffekte und Technologiesprünge bei der Produktion von Batterien und der damit angekündigten Vergünstigung von Elektrofahrzeugen, sind diese nach wie vor immer noch deutlich teurer. Zumindest ohne die Berücksichtigung der staatlichen Förderungen. Welche Folgen wird also der Wegfall der Förderung haben?
Zunächst geraten die Unternehmen massiv unter Druck. Die Dienstwagennutzenden werden weiterhin in Richtung Plug-in-Hybride und rein elektrische Fahrzeuge drängen. Denn die Vergünstigung bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils bleibt nach Wegfall der staatlichen Förderungen unverändert – auch bei den Plug-in-Hybriden. Interessant ist dabei, dass es bis dato kaum eine Positionierung seitens der Hersteller zu deren Anteil gibt. Das lässt vermuten, dass auch diese ihren Teil der Umweltprämie einstampfen werden. Die große Frage, die sich dann stellt, ist, ob Elektroautos ohne Umwelt- und Innovationsprämie dann noch konkurrenzfähig sind. Fakt ist, dass es schwierig wird. Interessanterweise wird es genau die Fahrzeugklassen treffen, die am nachhaltigsten sind – nämlich Kleinst- und Kleinwagen. Je größer der Batteriepack, desto größer der CO2-Rucksack aus der Produktion. Dazu gibt es ausreichend belastbare Studien. Insbesondere die kleinen, günstigen Elektroautos, die auch wirklich nachhaltig sind, trifft der Wegfall der Förderungen überproportional. Teilweise macht die Förderung dabei bis zu 50 Prozent des Gesamtpreises der Fahrzeuge aus.
Attraktivität der Elektrofahrzeuge-TCO schwindet
Erschwerend kommt die enorme Kostensteigerung im Strompreissegment hinzu. Wie sich diese in Kombination mit der aktuell verkündigten Deckelung auswirkt, kann im Moment niemand seriös abschätzen. Dazu muss man aber sagen, dass die Entwicklung bei den Verbrennerkraftstoffen ebenfalls alles andere als erfreulich und kalkulierbar ist. Allerdings ist das auch keine Genugtuung.
Entscheidend sind bei den gewerblich genutzten Fahrzeugen am Ende die Total Cost of Ownership (TCO). Der Kostennachteil aus dem höheren Wertverlust der Elektroautos wurde bisher durch die deutlich geringeren Betriebskosten über die Nutzungsdauer kompensiert. Durch den Wegfall der Subventionen und die durch die Energiekrise höheren Stromkosten verschiebt sich der Amortisationszeitpunkt nach hinten. Das bedeutet, der Zeitpunkt, ab dem sich ein Elektroauto gegenüber dem klassischen Verbrenner rechnet, tritt später ein. Wenn dieser Zeitpunkt über die übliche Nutzungsdauer eines Dienstwagens hinausgeht, rechnet sich das Elektroauto nicht mehr. Es hilft in diesem Fall nichts, wenn sich das Elektrofahrzeug rein rechnerisch nach viereinhalb Jahren bezahlt macht, das Unternehmen Fahrzeuge aber nur drei Jahre fährt.
Schnürt man ein Gesamtpaket – Wegfall der staatlichen und herstellerseitigen Prämie, höhere Stromkosten, Zusatzkosten für Ladeinfrastruktur und höhere Verwaltungsaufwendungen – dann wird schnell klar, dass die wirtschaftlichen Argumente „Pro Elektromobilität“ massiv schwinden. Mit Sicherheit wird dies schlussendlich dazu führen, dass Unternehmen von der (weiteren) Elektrifizierung Abstand nehmen. In der aktuellen Situation können es sich immer weniger Unternehmen leisten, Mehrkosten für Nachhaltigkeitsargumente in Kauf zu nehmen. Image hin oder her. Am Ende wird es insgesamt schwieriger für die Durchsetzung der Elektromobilität. Weniger Elektrofahrzeuge in Unternehmensfuhrparks bedeuten weniger günstige Gebrauchtwagen im Privatmarkt.

Autor: Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Marc-Oliver Prinzing gilt als einer der führenden Experten für Fuhrparkthemen. Der Diplom-Betriebswirt und Leasingfachwirt hat jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Aufgabenbereichen rund um das Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent im Rahmen des berufsbegleitenden Ausbildungsgangs zum zertifizierten Fuhrparkmanager bei der DEKRA Akademie und nimmt einen Lehrauftrag für Flottenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr.
Seit Oktober 2010 ist er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.). Kernaufgabe des Verbandes ist, die fachlichen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Belange und Interessen der Mitglieder zu vertreten. Der Verband fördert den Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder und bietet unterstützendes Know-how für das Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement an.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement (Ausgabe Dezember 2022)

(Dieter Grün, Sonderausgabe „der bauhofLeiter“)
Das Gesetz zur Umsetzung der überarbeiteten EU-Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge wird zum 2 August 2021 in Kraft treten. Dadurch werden in kommunalen Fuhrparks vermehrt Elektrofahrzeuge anzutreffen sein. Diese fallen aber auch in die Kategorie „elektrische Arbeitsmittel“ und Arbeitgeber haften für deren Sicherheit. Für Fuhrparkleitende und die Geschäftsführung bringt das Gesetz daher viel Verantwortung mit sich, die keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden sollte.
Die Anzahl elektrisch angetriebener Fahrzeuge in betrieblichen Flotten hat in den vergangenen Jahren bereits deutlich zugenommen – wenn auch noch auf niedrigem Niveau. Damit nehmen gewerbliche/berufliche Nutzer nicht nur in Sachen Energie- und Mobilitätswende eine wichtige Rolle ein. Sie profitieren auch von Förderprämien, Steuervorteilen und geringeren Wartungskosten.
Ab August muss insbesondere bei Kommunen und kommunalen Unternehmen sowie Sektorenauftraggebern ein Teil der Flotte zwingend emissionsarm oder -frei sein. Spätestens ab dann werden sich noch viel mehr Fuhrparkverantwortliche mit der Integration von Elektrofahrzeugen in der eigenen Flotte beschäftigen müssen. Da es sich dabei um wichtige Aspekte handelt, die nicht nur die Administration, sondern auch die betriebliche Sicherheit umfassen, sollten sich die betroffenen Verantwortlichen frühzeitig mit den künftigen Anforderungen vertraut machen. In diesem Zusammenhang stellen sich viele Frage betreffend Technik, Ladestrom, Sicherheit, rechtliche Vorgaben, Fördermöglichkeiten und Besteuerung, Personal oder auch Nutzungsüberlassung.
Hohe Sicherheitsansprüche
Einer der wichtigsten Faktoren ist die Sicherheit. Elektrofahrzeuge verfügen über empfindliche Technik. Das betrifft sowohl die verbaute Elektronik als auch das Zubehör. Die elektrischen Anlagen inklusive der Ladekabel von Elektro- und Hybrid-Dienstfahrzeugen müssen daher regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen und Prüfungen unterzogen werden.
Außerdem müssen die Anforderungen von gesetzlicher Unfallversicherung und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie die Haftung von Arbeitgeber beziehungsweise verantwortlicher Person im Betrieb im Auge behalten werden. Geklärt werden sollten zudem die Besonderheiten beim Umgang mit Pannen, Ladetechnik und Akkus. Für den regelkonformen Umgang im Fuhrparkmanagement zählt daher auch die Überprüfung von Ladekabeln und elektrischen Anlagen von Dienstfahrzeugen.
Denn Elektrizität ist für Menschen nicht
- riechbar
- schmeckbar
- tastbar
- hörbar
- sehbar
Kein Sinnesorgan warnt uns, wenn wir in die Nähe von gefährlichen spannungsführenden Teilen kommen!
Kontrolle ist Pflicht
Ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel in bestimmten Zeitfenstern zu überprüfen, soll deren ordnungsgemäßen Zustand gewährleisten. Das erhöht nicht nur die Sicherheit der direkten Beteiligten, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmender. Kommunale Fuhrparkfahrzeuge fallen in diesem Zusammenhang unter die Betriebssicherheitsverordnung und VDE Vorschriften. Entsprechend muss deren Beschaffenheit mindestens einmal pro Jahr begutachtet werden.
Dieser verpflichtende Check auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung umfasst die eigentliche Fahrzeugprüfung inklusive Kontrolle der Ladekabel. Durch eine rechtssichere Dokumentation ist zu ermitteln, ob sich die Arbeitsmittel – in diesem Fall also das E-Fahrzeug – in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Der Umfang umfasst unter anderem Sicht- und Funktionsprüfung, Messen, Dokumentation inklusive Prüfprotokoll, Auswertung sowie Vereinbarung des nächsten Kontrolltermins.
Der ordnungsgemäße Zustand einer elektrischen Anlage oder eines Betriebsmittels betrifft neben den Maßnahmen zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit und des Brandschutzes auch alle Instrumente zum sicheren Betrieb. Dazu zählen etwa Einrichtungen zum Schutz gegen mechanische, hydraulische, optische oder andere Gefährdungen. Im Übrigen dürfen bei Überprüfung der Elektronik auch Aspekte wie Bordcomputer, Steckvorrichtungen oder Verteiler beziehungsweise Wandler nicht vergessen werden.
Vorbeugen statt bereuen
Bei Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen im Rahmen der UVV drohen empfindliche Strafen. Egal ob bewusst oder unbewusst gegen die Vorschriften verstoßen worden ist: Kommt es zu einem Unfall, muss die Firma nachweisen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten worden sind. Ist das nicht der Fall, können auf Arbeitgeber und Fuhrparkverantwortliche hohe Regressansprüche und bis zu 10.000 Euro Strafe im Sinne einer Ordnungswidrigkeit zukommen.
Spezielle Weiterbildungen helfen, sich durch den Dschungel aus Vorschriften und Anforderungen zu wühlen. So hat beispielsweise der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. ein breit angelegtes Seminar- und Selbstlernangebot rund um UVV, Besteuerung, Rechtsfragen, Administration, Nutzungsüberlassung und Ladestruktur geschaffen, um Fuhrparkverantwortlichen den Einstieg in die Elektromobilität zu erleichtern. Mittels kompakten Online-Selbstlernkursen können sich die Teilnehmenden wichtiges Know-how zeit- und ortsunabhängig selbst aneignen.

Sie wollen Elektromobilität einführen und managen? Dafür brauchen Sie einen umfassenden Überblick? Dann nutzen Sie das Angebot Fleetricity des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (www.fleetricity.de).
- Fleetinstruct - UVV Unterweisung: Dienstwagenfahrende jährlich wiederkehrend unterweisen; es werden die wichtigsten Themen bezüglich (auch elektrischer) Fahrzeugnutzung dargestellt.
- Fleetricity – umfassende und fokussierte Einführung in die E-Mobilität im Fuhrpark: Es werden alle für Unternehmensfuhrparks relevanten Faktoren der E-Mobilität vermittelt.
- Besteuerung von E-Fahrzeugen: Thematisiert werden die wichtigsten rechtlichen Aspekte in Bezug auf die Besteuerung von E-Fahrzeugen.
- Car-Policy bei E-Fahrzeugen: Der Kurs bietet Kenntnisse über alles, was bei der Gestaltung einer Car-Policy bei E-Fahrzeugen zu beachten ist.
- Rechtsfragen der E-Mobilität: Dreht sich um maßgebliches juristisches Wissen hinsichtlich Implementierung und Management von E-Mobilität im Fuhrpark.
- Nutzungsüberlassungsverträge bei E-Fahrzeugen: Gibt einen fundierten Überblick zu Nutzungsüberlassungsverträgen bei E-Autos.
- Laden von E-Fahrzeugen im Fuhrpark: Alles, was Fuhrparkverantwortliche zum Thema Ladeinfrastruktur und Laden von E-Fahrzeugen wissen müssen.
- Fuhrparkmanagement bei E-Fahrzeugen: Grundlegendes Wissen zum Fuhrparkmanagement von E-Autos.

Autor: Dieter Grün, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Dieter Grün ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) in Mannheim und Fuhrparkleiter in einem kommunalen Betrieb.
Veröffentlicht: Sonderausgabe „der bauhofLeiter“
Mobilitätswende
(Axel Schäfer, Electrive.net – Flotten-Newsletter. Gastbeitrag BBM e.V. zum Thema „Forderungen an die neue Legislatur“ 12/2021)
Nun stehen sie alle fest – die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung. Einer ganz besonderen Herausforderung darf sich Volker Wissing stellen, er wird der neue Verkehrsminister. Er darf sich künftig mit der dringend nötigen Mobilitätswende auseinandersetzen, die spätestens wieder seit der UN-Klimakonferenz im November in den Fokus gerückt ist.
Nun stehen sie alle fest – die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung. Einer ganz besonderen Herausforderung darf sich Volker Wissing stellen, er wird der neue Verkehrsminister. Er darf sich künftig mit der dringend nötigen Mobilitätswende auseinandersetzen, die spätestens wieder seit der UN-Klimakonferenz im November in den Fokus gerückt ist.
Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP bietet bereits gute Ansätze zur Bekämpfung des Klimawandels und gibt erste Einblicke in die künftigen Tätigkeitsfelder des neuen Verkehrsministers. Um dem Klimawandel endgültig entgegenzuwirken, bedarf es aber weiteren Maßnahmen. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) hat dazu konkrete Impulse und Forderungen entwickelt, um den Mobilitätswandel in Unternehmen weiter anzukurbeln.
Damit Unternehmensmobilität langfristig bestehen kann, muss sie sowohl ökonomisch als auch ökologisch tragfähig sein. Die Weichen dafür muss die neue Regierung in einem Masterplan stellen. Die wichtigsten Treiber in der Wende sind zum einen alternative Antriebsarten als Beitrag zur Dekarbonisierung bis 2050 und zum anderen eine weiter zunehmende Geschwindigkeit der Digitalisierung. Hier ist aktives Handeln der nächsten Bundesregierung gefragt.
In ihrem Koalitionsvertrag setzen die Parteien zur Veränderung der Mobilität vor allem auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und den Hochlauf der Elektromobilität. Das Ziel: Deutschland als Leitmarkt für E-Mobilität mit mindestens 15 Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 etablieren. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel – aber wichtig. Allerdings kann Elektromobilität auf lange Sicht nur funktionieren, wenn die entsprechende Ladeinfrastruktur gegeben ist. Und da sehen wir noch immer Probleme.
Elektromobilität als das Non plus ultra?
Elektromobilität scheint – zumindest aus Sicht der Regierung – das Mittel auf dem Weg in die Nachhaltigkeit. Dafür bedarf es aber noch einigen Veränderungen. Insbesondere die Frage der Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und ein verbindliches Roaming-System für Ladestrom-Tarife sollten im Rahmen eines Masterplans festgelegt werden. Der derzeit herrschende Tarifdschungel verursacht bei Fuhrparkmanager:innen einen erheblichen Mehraufwand. Durch die Vielzahl der Anbieter bestehen abweichende Zahlungsmittel und Konditionen, was die Abrechnung der Ladevorgänge unnötig erschwert. Hier wäre beispielsweise die Vorgabe eines einheitlichen Zahlungsmittels, das immer an Ladestationen nutzbar sein sollte, sinnvoll. Zur Veränderung der Ladesituation will die neue Regierung aber hauptsächlich auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur setzen.
Das Ziel im Koalitionsvertrag, bis 2030 eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte zu haben, ist zwar wichtig, um die Elektromobilität attraktiv zu halten, zu den Schwierigkeiten des Ladens zählt aber nicht nur die Anzahl an Ladesäulen. Die Anreize für E-Autos werden vor allem durch die Vielfalt an Tarifen und den teilweise fehlenden Wettbewerb gehemmt. Die Regierung setzt auf Transparenz der Preise und will das Laden durch einen öffentlich einsehbaren Belegungsstatus vereinfachen. Dem Tarifdschungel wirkt das aber noch nicht entgegen. Wir haben in Deutschland mehrere hundert verschiedene Tarife, deren preisliche Spanne sehr weit auseinandergeht. Um dem entgegenzuwirken wäre eine Preisdeckelung in einem ersten Schritt sinnvoll. Anbieter nutzen staatliche Mittel in beachtlicher Höhe, verlangen auf der anderen Seite aber utopische Preise. Das darf nicht sein. Eine Preisdeckelung könnte dem entgegenwirken.
Fördermittel überdenken
Ebenso zu überdenken ist die staatliche Förderung alternativer Antriebe. Zur Erreichung des Mobilitätswandels mit nachhaltig ökologischer Wirkung ist eine stärkere Differenzierung der Förderung erforderlich. Die Förderung von PlugIn-Hybriden ist nicht zielführend, da diese zwar die Automobilindustrie bei der Erreichung von CO2-Vorgaben begünstigt, in der Praxis aber kein nennenswerter Nachhaltigkeitseffekt sichtbar ist. Außerdem werden diese Fahrzeugtypen zu wenig elektrisch betrieben. Als Anreiz für den Kauf dient meist der Dienstwagensteuervorteil – nachhaltige Aspekte spielen häufig keine Rolle. Die künftige Regierung schafft den Vorteil für PlugIn-Hybride zwar nicht ab, möchte aber in Zukunft nur noch steuerliche Vorteile gewähren, wenn das Fahrzeug überwiegend, das heißt, mit mehr als 50 Prozent, im rein elektrischen Fahrantrieb betrieben wird. Damit werden Anreize gesetzt, diese Fahrzeuge möglichst emissionsfrei zu betreiben.
Um den Hochlauf der Elektromobilität zu begünstigen, setzt die Koalition allerdings noch immer auf Fördermaßnahmen für PlugIn-Hybride. In diesem Zug soll die zum Jahresende auslaufende Innovationsprämie um ein Jahr verlängert werden. Erst 2023 soll die Nutzung von PlugIn-Hybriden überprüft werden und die Förderung an eine elektrische Mindestreichweite geknüpft sein. Das ist ein wichtiger und guter Schritt, kommt aber reichlich spät. Wir als Fuhrparkverband erachten die Förderung immer noch als falsch. Es geht bei der Mobilitätswende nicht um den Ausbau der Elektromobilität, sondern um die Reduzierung der CO2-Emissionen. Noch ist nicht erkennbar, dass PlugIn-Hybride daran einen großen Anteil leisten.
Mobilitätsalternativen schaffen
Unternehmen mit betrieblichem Fuhrpark nehmen eine Schlüsselfunktion beim Mobilitätswandel ein. Die Mobilität der Arbeitnehmer:innen kann aber nur durch intelligente Unternehmensstrategien und punktuelle öffentliche Unterstützung verändert werden. Um den Wandel hin zu ökologischen Alternativen zu vollziehen, muss das Blickfeld geöffnet werden. Forderungen nach einem absoluten „Verbot aller Verbrennerfahrzeuge“ stellen Unternehmen vor unlösbare Probleme, wenn beispielsweise Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in erforderlicher Größe und Leistungsfähigkeit noch nicht vorhanden sind.
Die UN-Klimakonferenz hat gezeigt, dass das „Verbrenner-Aus“ immer noch ein Thema ist. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte allerdings noch kein Verbrenner-Verbot beschlossen werden, solange es keine ausreichenden Alternativen gibt. Deutschland setzt vordergründig auf Elektromobilität, ohne dass dafür die geeigneten Mittel vorhanden sind. Zum jetzigen Zeitpunkt herrscht bei der neuen Regierung Einigkeit darüber, dass bis 2035 nur noch Null-Emissionen-Fahrzeuge neu zugelassen werden sollen. Damit ist aber noch nicht das endgültige Verbot des Verbrenners beschlossen – alternative Kraftstoffe wie eFuels könnten durchaus Teil der Lösung sein. Das wäre wünschenswert. Außerdem sollten bereits vorhandene und bewährte Technologien (beispielsweise CNG) als Übergangslösungen genutzt und gefördert werden.
Lösungsansätze
Um den Mobilitätswandel zu bestreiten, bedarf es eines Masterplans der Regierung. Dadurch ist nicht nur eine Verbesserung bei der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit möglich, sondern auch eine Steigerung in der Qualität der Mobilitätsangebote. An erster Stelle des Masterplans sollte ein Mobilitätsgesetz stehen, das regulatorische Rahmenbedingungen auch für die betriebliche Mobilität schafft.
Ein weiterer wichtiger Aspekt eines Masterplans zur Mobilitätswende ist die hürdenfreie Bereitstellung von Mobilitätsdaten. Außerdem muss das Recht auf die eigenen Daten des Datengebers gewährleistet sein. Fahrzeughersteller dürfen nicht Eigentümer und Verfügungsberechtigte über Daten der Fahrzeugnutzer:innen sein, da hierdurch sinnvolle durch Dritte angebotene Services zur Verbesserung der Mobilität eingeschränkt würden.
Zudem muss der Masterplan die Angleichung steuerlicher Gegebenheiten beinhalten. Derzeit werden Unternehmen durch je nach Bundesland abweichenden Regelungen eingeschränkt, wenn sie ihren Mitarbeitenden den Zugang zu alternativen Mobilitätsmitteln wie Fahrrädern oder ÖPNV ermöglichen. Dem muss entgegengewirkt werden.
Zuständigkeiten müssen geregelt werden
Eine erforderliche Grundlage für den Mobilitätswandel ist es, Zuständigkeiten, Entscheidungs- und Umsetzungskompetenzen für alle Mobilitätsmittel zu bündeln. Das betrifft nicht nur die Organisation der verantwortlichen Ministerien, sondern auch die Interaktion der nachgeordneten Behörden und Gesellschaften im Bundesbesitz. Der Bund muss die dazu nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Die Verantwortung für die Gestaltung des Mobilitätswandels sollte weiterhin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gebündelt sein, das aber als Bundesministerium für Mobilität auftreten sollte.
Um die Probleme aus dem Weg zu räumen, denen Unternehmen derzeit bei der Gestaltung des Mobilitätswandels ausgesetzt sind, ist die Umsetzung des Masterplans sinnvoll. Es bedarf einer Kombination aus gesetzlichen Vorgaben und Nutzerfinanzierung (Push) und Angebotsverbesserungen in Qualität und Quantität (Pull). Der Handlungsbedarf ist groß, eine strategisch ausgerichtete und gebündelte Vorgehensweise wird uns aber schneller machen, Kosten reduzieren und Unmut verhindern. Alle sollen Lust bekommen an nachhaltigen Verbesserungen mitzuwirken.

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Electrive.net – Flotten-Newsletter 12/2021
Mobilitätsmanagement

(Marc-Oliver Prinzing, Zeitschrift Flottenmanagement - Ausgabe Oktober 2022)
Noch lange sind Themen wie Mitarbeitermobilität, Mobilitätsbudget und alternative Antriebe nicht in jedem Unternehmen angekommen. Dabei ist die Beschäftigung mit diesen Aspekten nicht nur notwendig, sondern auch zukunftsweisend. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss sich schon heute mit allen Fragen rund um das Mobilitätsmanagement auseinandersetzen. Fünf Gründe zeigen, wieso die betriebliche Mobilität für Unternehmen, die Geschäftsleitung und auch für Fuhrparkverantwortliche relevant ist.
Nicht zuletzt seit der Coronapandemie haben sich viele Arbeitsprozesse verändert, die Digitalisierung ist vorangeschritten und auch Mobilitätsbedürfnisse haben sich – zunächst zwangsweise – gewandelt. Ein Change, auch für Fuhrpark- und Mobilitätsthemen. Die Entwicklung hin zu einem veränderten Mobilitätsmanagement ist aber nicht nur aufgrund der äußeren Umstände notwendig, sondern auch wichtig und sinnvoll. Die Pandemie hat gezeigt, dass Veränderungen möglich sind. Sie zwang zu einer reduzierten Mobilität. Geschäftsreisen und Pendeln zur Arbeitsstelle waren in großen Teilen nicht mehr nötig oder sogar unmöglich. Hinzu kommen aktuelle Probleme wie etwa Lieferschwierigkeiten, die Flexibilität von Unternehmen in vielen Bereichen erfordern. Der Firmenfuhrpark wird in vielen Fällen auch weiterhin das mobile Herz bleiben, es zeigt sich jedoch, dass die Mobilität weitergedacht werden muss.
Mitarbeitermobilität in den Fokus stellen
1. Unternehmen beziehungsweise Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche müssen auf das veränderte Mobilitätsverhalten reagieren und die Mobilität entsprechend anpassen. Dieser Aspekt ist einer der wesentlichen Gründe, warum die Betrachtung der Mobilität in Betrieben unerlässlich ist. Eine immer dringender werdende Aufgabe der Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen ist die Analyse der betrieblichen Mobilität. An erster Stelle muss die Feststellung des Ist-Zustands stehen, um in einem nächsten Schritt herauszuarbeiten, wie die Mobilität verändert und an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst werden kann. Längst ist das Instrument Dienstwagen um viele weitere Möglichkeiten ergänzt worden und nicht mehr alternativlos. Mitarbeitende entwickeln ein Nachhaltigkeitsbewusstsein oder es besteht schlichtweg nicht mehr die Notwendigkeit, Fahrten mit dem Auto zu tätigen. Wenn sich Betriebe daran anpassen, machen sie einen wichtigen Schritt in die Zukunft.
2. Damit eng verbunden ist ein weiterer Grund, sich besser gestern als heute mit der betrieblichen Mobilität zu befassen: die Mitarbeitenden und das Image. Im Kampf um Mitarbeitende zählt jedes Argument für ein Unternehmen. Ist das Mobilitätsmanagement optimal auf die Bedürfnisse der Angestellten angepasst, steigt die Arbeitgeberattraktivität und die Zufriedenheit mit dem Unternehmen. Das dient nicht nur der Mitarbeitergewinnung, sondern hält auch die Angestellten eher im Unternehmen. Gleichzeitig steigt das Image von Unternehmen sowohl innerbetrieblich als auch von außen gesehen. Die Umstellung der Mobilität kommt häufig einer nachhaltigeren Ausrichtung nach. Themen wie nachhaltiges Wirtschaften und ein nachhaltig ausgerichtetes Mobilitätsmanagement leisten aktiv einen Beitrag zur Mobilitätswende. Wenn sich Unternehmen demnach mit der betrieblichen Mobilität auseinandersetzen, wird das von der Außenwelt positiv wahrgenommen. Häufig spielt für Kundinnen und Kunden die Nachhaltigkeit eine tragende Rolle. Deswegen können Unternehmen mit einem angepassten Mobilitätsmanagement nicht nur im Kampf um die Mitarbeitenden gewinnen, sondern auch bei den Kundinnen und Kunden.
Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll
3. Ein weiterer Grund, sich jetzt mit der betrieblichen Mobilität auseinanderzusetzen, ist demnach auch die Nachhaltigkeit. Das gilt nicht nur aus Imagegründen, sondern auch aus persönlichen Gründen. Für viele Unternehmen und Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche spielt nachhaltiges Wirtschaften mittlerweile eine große Rolle im Arbeitsalltag. Mit der Umstellung der betrieblichen Mobilität lassen sich massive Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit erzielen und somit gelingt ein großer Schritt hin zur Mobilitätswende. Konzepte wie das Mobilitätsbudget, Job-Tickets oder Poolfahrzeuge können einen wichtigen Beitrag leisten, um den Emissionsausstoß in Unternehmen zu reduzieren und die Nachhaltigkeit im Fuhrpark voranzubringen. Dies macht nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen Sinn.
4. Aus diesem Grund spielt auch die Kostenreduzierung eine Rolle bei der Umgestaltung der betrieblichen Mobilität. Es liegt an den Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen, die Mobilität in der bestehenden Form zu überprüfen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um eine Umgestaltung anzuregen. Durch den veränderten Mobilitätsbedarf sind möglicherweise mehr Dienstwagen vorhanden, als überhaupt benötigt werden. Durch eine strukturierte Veränderung lassen sich Fahrzeuge und Emissionen einsparen und gleichzeitig die Kosten enorm reduzieren. Hinzu kommt, dass sich Elektrofahrzeuge auf längere Sicht eher rechnen als Verbrenner. Handeln Unternehmen im Sinne der Mobilitätswende und gestalten den Fuhrpark nachhaltig um, ist das nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich. Damit im Zusammenhang steht ein weiterer Grund, der für die Fokussierung der betrieblichen Mobilität spricht: die Elektroauto-Förderung. Viele Unternehmen haben bereits die Notwendigkeit einer Elektrifizierung zumindest als Ergänzung erkannt – und das nicht erst, seit das Verbrenner-Aus droht. Nach den neusten Entwicklungen ist allerdings auch klar, dass es einen Stopp der Zuschüsse für Elektroautos bezüglich der Unternehmen geben soll.
5. Nach jetzigem Stand wird die Förderung für Elektroautos für Unternehmen zum September 2023 eingestellt. Ab dann sollen nur noch Privatpersonen unterstützt werden. Wenn sich Unternehmen bisher noch nicht mit dem Thema der Mobilitätswende und der Umstellung der betrieblichen Mobilität auseinandergesetzt haben, wird es höchste Zeit. Noch besteht die Chance, die Flotte zu elektrifizieren und von den staatlichen Förderungen zu profitieren. Eine Umrüstung auf Elektrofahrzeuge beziehungsweise alternative Antriebe ist angesichts des Verbrenner-Aus nahezu unumgänglich. Aus diesem Grund sind Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche dem Thema Mobilitätsmanagement zwangsweise verschrieben und eine Umgestaltung muss ausgearbeitet werden – besser gestern als heute.
Weitere Informationen: www.mobilitaetsverband.de

Autor: Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Marc-Oliver Prinzing gilt als einer der führenden Experten für Fuhrparkthemen. Der Diplom-Betriebswirt und Leasingfachwirt hat jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Aufgabenbereichen rund um das Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent im Rahmen des berufsbegleitenden Ausbildungsgangs zum zertifizierten Fuhrparkmanager bei der DEKRA Akademie und nimmt einen Lehrauftrag für Flottenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr.
Seit Oktober 2010 ist er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.). Kernaufgabe des Verbandes ist, die fachlichen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Belange und Interessen der Mitglieder zu vertreten. Der Verband fördert den Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder und bietet unterstützendes Know-how für das Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement an.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement (Ausgabe Oktober 2022)
(Axel Schäfer, Gastbeitrag für die F.A.Z. – 03/2022)
Die Lieferung von Neufahrzeugen verzögert sich, die Preise von Mietfahrzeugen steigen – durch den Mangel an wichtigen Halbleitern müssen Automobilhersteller ihre Produktion seit Monaten drosseln. Was bedeutet das für das Mobilitätsmanagement von Unternehmen?
Seit fast einem Jahr stehen vielerorts die Produktionsbänder der Autoindustrie ganz oder teilweise still. Kurzarbeit ist wieder angesagt. Grund dafür ist der Chipengpass, mittlerweile auch bekannt als Halbleiterkrise. Das wird sich so schnell auch nicht normalisieren, denn die Ukraine-Krise verschärft die Situation zusätzlich. Die Nachfrage nach den Chips ist enorm, die Fertigung hinkt hinterher und die Rohstoffgewinnung hat durch Werksschließungen in der Ukraine einen zusätzlichen Dämpfer erhalten – es kommt zu Lieferengpässen und Produktionsstopps in der Autoindustrie. Im Ergebnis wurden 2021 rund fünf Millionen Neuwagen weniger gefertigt als geplant. Kunden müssen Geduld haben und höhere Preise zahlen.
Kurzfristiges Denken weicht langfristiger Krise
Wie es so weit kommen konnte, hat unterschiedliche Ursachen. Eine ungünstige Kombination aus Covid-19-Pandemie, Natur- und Kriegskatastrophen sowie Fehlplanungen der Autohersteller. Während der Lockdowns lag der Neuwagenverkauf brach. Nicht nur, dass die Autohäuser geschlossen hatten. Mit zunehmender Kurzarbeit oder gar betriebsbedingten Kündigungen, Betreuungsengpässen für Kinder und einer daraus resultierenden finanziellen Not, stand ein Neuwagen bei vielen nicht gerade oben auf der Anschaffungsliste.
Die Automobilbranche reagierte darauf, indem sie unter anderem weniger Chips bestellte. Was auf den ersten, flüchtigen Blick logisch erscheint, wirkt auf den zweiten, kritischen Blick so als würden die Hersteller nicht über den Tellerrand hinausblicken. Denn spontane Bestellvorgänge mögen in der Automobilindustrie üblich sein, die Halbleiterindustrie zeichnet sich aber durch monatelange Fertigungszyklen und gleichzeitig einer begrenzten Haltbarkeit der Chips aus. Vorausschauende Planung ist daher unerlässlich. Die Halbleiterkrise geht damit auch auf das Konto der Hersteller.
Einseitige Abhängigkeit
Die Chiphersteller sind nicht von der Autobranche abhängig, Pkws können heutzutage aber ohne die essenziellen Halbleiter nicht gebaut werden. Schätzungen zufolge finden nur rund zehn Prozent davon eine Verwendung in Fahrzeugen. Während die allgemeine Nachfrage im Zuge des coronabedingten Digitalisierungsschubs nach oben schnellte, stehen die Autobauer nun ganz unten auf der Warteliste. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass das Geschäft mit den Chips in anderen Bereichen binnen kürzester Zeit derart boomen würde, dass sie sich durch ihren Sparkurs letztlich selbst schaden.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich der deutsche Automarkt zu einem beachtlichen Teil von rund 70 Prozent von einem in Japan ansässigen Chiphersteller einseitig abhängig gemacht hat. Jeder Störfaktor wie beispielsweise ein Fabrikbrand oder Naturkatastrophen wie ein für Japan – wie erst kürzlich wieder erlebt – gar nicht so unübliches Erdbeben verlängert die Wartezeiten. Hinzu kommen ein Mangel an Arbeitskräften, zu kleine Fabrikhallen und zu wenige Fertigungsmaschinen. Letztere können – ironischerweise – nur mittels Chips gefertigt und gesteuert werden. Und das vom Halbleiterhersteller TSMC für Europa geplante Werk wird vorerst (noch) nicht gebaut werden. Coronabedingte Lieferengpässe für Bauteile, Lockdowns in der Produktion oder gar ganze Werksschließungen nähren den Teufelskreis zusätzlich. Die Situation ist in Werken in den USA, China, Vietnam, Thailand und Malaysia dieselbe.
Und mehr noch: Die Lieferkette für die Materialien der Chips läuft nicht reibungslos. Ohne Silizium gibt es keine Chips. Das stammt allerdings zu einem großen Teil aus China und dort gab es Ende letzten Jahres immense Produktionsengpässe, gefolgt von einer beachtlichen Preissteigerung. Dazu verzerrt der Krieg in der Ukraine den Nachschub an Neon. Rund die Hälfte des global verwerteten Neons stammt aus der Ukraine. Und dort steht die Gewinnung des dringend benötigten Gases seit Kriegsbeginn still.
Auswirkungen auf das Mobilitätsmanagement
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Situation enorm angespannt ist. Und das nicht nur für Autobauer und Neuwagenhändler. Millionen nachgefragter Pkw werden auch 2022 nicht gebaut werden können. Mit rund 97 Prozent sind nahezu alle Produzenten und Zulieferer von der nun auch kriegsbedingten Knappheit betroffen. Das hat immense Auswirkungen auf die betrieblichen Flotten. Besonders beliebt sind Wagen und Nutzfahrzeuge der Marken VW, Audi und BMW. Alle drei leiden unter den Lieferengpässen. Zudem werden die einsetzbaren Teile dann nicht unbedingt in klassischen Flottenmodellen verbaut. Und wenn es ein Fahrzeug gibt, dann überschreitet die Lieferfrist deutlich die sonst üblichen sechs bis acht Wochen. Für bestimmte Modellreihen muss schnell mal ein Jahr gewartet werden. Das bedeutet: Leasing-Verträge mit dem alten Wagen laufen aus, aber das Nachfolgemodell wird nicht geliefert. Es müssen Verträge verlängert werden oder man setzt zur Überbrückung auf Mietwagen. Das wird aus den genannten Gründen aber ziemlich kostspielig.
Moderne Lösungen für neuzeitliche Probleme
Eine Entwarnung ist so schnell nicht in Sicht, zumal auch niemand weiß, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickeln wird. In Fachkreisen wird befürchtet, dass sich der Mangel noch mindestens bis zum Sommer ziehen wird, vielleicht sogar bis 2023 oder 2024. Außerdem werden Neuwagen durch den Produktionsengpass immer teurer, was sich insgesamt in den monatlichen Leasingraten widerspiegelt. Wem die Flottenkosten nicht davonlaufen sollen, muss sich dringend Gedanken um Alternativen machen. So bekommt das Thema Mobilitätswende einen völlig neuen Input. Über Alternativen wie Mobilitätsbudgets wird plötzlich intensiver nachgedacht – und es bleibt nicht beim Denken. Unsichere Zeiten wie diese zeigen einmal mehr wie wichtig es ist, mit Erfahrung, Know-how und Weitsicht zu planen und zu agieren. Und im Sinne eines Business Continuity Management einen Plan B zu haben. Alternative Mobilitätskonzepte und ein besser eingeschätzter Fahrzeugbedarf könnten Lösungsansätze sein und einen ersten Schritt in Richtung mehr Unabhängigkeit vom Automobil bedeuten.

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Gastbeitrag für die F.A.Z. – 03/2022

(Axel Schäfer, Zeitschrift Flottenmanagement 02/2022)
Die betriebliche Mobilität mit zu verantworten, bedeutet lebenslanges Lernen. Rahmenbedingungen, Prozesse und die Mobilitätsbedürfnisse verändern sich, oft schleichend aber manchmal erschreckend schnell. Die Digitalisierung schreitet voran und eröffnet neue Möglichkeiten. Daher sollte, nein muss auch das Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement immer wieder angepasst werden. Dabei gilt es diverse Fehler zu vermeiden, die die Fuhrparkkosten zukünftig in die Höhe treiben. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres bietet sich deshalb eine Umstrukturierung des Fuhrparks an, um Kosten zu sparen.
Einer der größten Fehler, bei dem die Unternehmen gleichzeitig am tiefsten in die Tasche greifen müssen, sind die Gesamtkosten. Diese müssen über den gesamten Nutzungszyklus eines Fahrzeuges berechnet werden und werden häufig außer Acht gelassen. Die Investitionsentscheidung wird vordergründig vom Anschaffungspreis abhängig gemacht, Folgekosten werden nicht in Betracht gezogen. Dabei ist die ganzheitliche Kostenbetrachtung, die Total Cost of Ownership (TCO), die Grundlage für einen betriebswirtschaftlich funktionierenden Fuhrpark. Ein niedriger Einkaufspreis eines Fahrzeugs korrespondiert nicht gleichzeitig mit vergleichsweise niedrigen Kosten über den gesamten Lebenszyklus im Unternehmen. Die Anschaffungskosten sind lediglich die Spitze des Eisbergs. Die TCO zielt deshalb darauf ab, mögliche Kostentreiber und versteckte Kosten im Vorfeld aufzudecken. Das ist bei einer Neuanschaffung grundlegend, insbesondere wenn es um alternative Antriebe geht. Betrachtet man lediglich die Anschaffungskosten, kann ein falsches Bild entstehen. Alternative Antriebe, wie Elektroautos, sind zwar häufig in der Anschaffung teuer, können sich aber auf lange Sicht bezahlt machen. Schließt man Alternativen zum klassischen Verbrenner aufgrund der Anschaffungskosten von vorneherein aus, kann das nicht nur zu höheren Kosten führen, man verwehrt sich auch der Mobilitätswende und dem nachhaltigen Fuhrpark.
Fatal kann im Fuhrparkmanagement auch ein fehlendes Schaden- und Riskmanagement sein. Ein richtiges Schadenmanagement kann Prozesse vereinfachen, Ausfallzeiten minimieren, weiteren Schäden vorbeugen und somit Kosten reduzieren. Zum Schadenmanagement eines jeden Fuhrparks sollten präventive Maßnahmen wie Schulungen, Nutzerkreiseinschränkungen und Anreize wie Bonus-Malus-Systeme gehören. Außerdem sollten wichtige Hinweise zum Vorgehen im Schadenfall im Dienstwagenüberlassungsvertrag festgehalten werden. Hierbei sei aber gesagt, dass nicht nur die Fahrer:innen ein operationelles Risiko darstellen, sondern auch die Fuhrparkmanagenden selbst. Auch sie sind regelmäßig in Bereichen wie Kontrollpflicht der Führerscheine und UVV zu schulen.
Das Riskmanagement beschreibt alle Aktivitäten im Umgang Risiken, die sich aus dem Betrieb eines Fuhrparks ergeben. Dazu zählen insbesondere die Messung (Risikocontrolling) und die Optimierung (Risikosteuerung) eines Ertrags-Risiko-Profils. Wenn man die Risiken kennt und einschätzen kann, lassen sich präventive Maßnahmen implementieren, die Einsparpotenzial bieten. Zu den Vorteilen, die sich aus einem Riskmanagement ergeben, gehören unter anderem die Reduzierung der Schadenhäufigkeit und -aufwendungen, eine langfristige Kostenstabilität sowie die Reduzierung des Aufwands der Schadenbearbeitung. Damit spart man gleichzeitig Mitarbeiterkapazitäten ein, die sich wiederum positiv auf die Fuhrparkkosten auswirken.
Außerdem ist ein funktionierendes Prozessmanagement unabdingbar – das beginnt bei der Ausschreibung und endet bei der Aussteuerung und der Fahrzeugrückgabe, bei der heute viele Unternehmen hohe Summen an Lehrgeld zahlen.
Auch ohne eine angemessene Car Policy können die Kosten für den Fuhrpark unnötig in die Höhe schießen. Ein gern genutztes Mittel bei der Mitarbeitermobilität ist der Dienstwagen. Fehlende Spielregeln für Fahrer:innen im Umgang mit den Fahrzeugen machen allerdings immer wieder Sorgen. Auch wenn häufig von Unternehmen die Privatnutzung der Dienstwagen angeboten wird, handelt es sich immer noch um Firmeneigentum. Allerdings gehen nicht alle Fahrer:innen pfleglich damit um. Deswegen sollten Fuhrparkverantwortliche darauf achten, die Nutzung des Dienstwagens umfassend zu regeln, um unschöne Kosten zu vermeiden. Außerdem haben die Fahrer:innen und das Fahrverhalten einen großen Einfluss auf die variablen Kosten hinsichtlich Verbrauch, Schäden und Verschleiß. Fuhrparkmanagende sollten deshalb konkrete Regeln im Umgang mit den Fahrzeugen aufstellen. PlugIn-Hybride beispielsweise hauptsächlich im Verbrennermodus zu nutzen – das schadet nicht nur der Umwelt, sondern in besonderem Maße auch dem Kraftstoffbudget. Begrenzt man die Höhe der Tankkosten kann man gleichzeitig auch festlegen, dass Mitarbeitende die Mehrkosten selbst tragen müssen. Damit kann man nicht nur die Fuhrparkkosten verringern, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Ein fehlendes Nachhaltigkeitsbewusstsein kann ebenfalls die Kosten treiben. Auch wenn in vielen Fuhrparks die Mobilitätswende bereits vorangebracht wird, gibt es immer noch Fuhrparkmanagende, die eine Umstellung als unwirtschaftlich oder nicht notwendig erachten. Dabei kann man durch einen Austausch der Flotte Geld sparen. Mit Blick auf die Klimaschutzziele und die Emissionsbeschränkungen ist davon auszugehen, dass Kosten für Verbrenner deutlich steigen werden. Betrachtet man die steigenden Spritpreise in den vergangenen Wochen und Monaten ist ein Umstieg allein deshalb schon sinnvoll, um die Kosten zu reduzieren.
Wer vor lauter operativen Aufgaben keine längerfristige Strategie entwickelt, auch der kann in die Kostenfalle tappen. Vor allem sollte es eine Strategie zur Entwicklung und Optimierung der betrieblichen Mobilität geben. Nicht erst seit der Coronapandemie hat sich das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert. Gerade junge Mitarbeitende haben häufig keinen Führerschein, Homeoffice und Co. machen die Mobilität außerdem überflüssig. Es liegt an den Mobilitätsverantwortlichen eines jeden Fuhrparks, die Mobilität nicht nur an die Mobilitätserfordernisse des Unternehmens, sondern auch an die Mitarbeiter:innen anzupassen. Häufig ist es gar nicht mehr notwendig, dass es Dienstwagen gibt, da sie kaum genutzt werden. Durch eine Umstellung beziehungsweise Reduzierung der Flotte lässt sich auch in diesem Punkt einiges sparen. Ein wichtiges Mittel können Mobilitätsbudgets sein, bei der sich die Mitarbeitenden das Geld zur Nutzung der Mobilitätsmöglichkeiten selbst einteilen können.
Dass auch die Digitalisierung noch immer ein Problem in Fuhrparks darstellt, ist in Zeiten der Pandemie eigentlich kaum vorstellbar. Die Realität zeigt aber, dass noch viele vor der Digitalisierung zurückschrecken und auf manuelle Prozesse setzen. Dabei können eine Fuhrparkmanagement-Software oder der Einsatz von elektronischen Führerscheinkontrollen den administrativen Aufwand erheblich verringern. Je größer die Flotte desto größer ist der Aufwand. Digitalisierungen können da eine Menge Arbeit abnehmen und somit Zeit und Kapazitäten sparen, was gleichzeitig die Fuhrparkkosten senkt.
Durch eine Umstrukturierung der Prozesse und eine Umstellung der Flotte, lassen sich nicht nur Zeit und Kapazitäten einsparen, sondern vor allem auch Kosten. Fuhrparkverantwortliche sollte sich nicht vor neuen Möglichkeiten wie der Digitalisierung oder den alternativen Antrieben verschließen. Vielmehr sollten sie auf eine ständige Optimierung des Fuhrparks bedacht sein.
Infografik/Checkliste
Sieben Wege, wie Sie die Fuhrparkkosten in die Höhe treiben
Wenn das Ihr Ziel ist, müssen Sie folgendes unbedingt beachten:
- Gesamtkosten über den Nutzungszyklus eines Fahrzeug außer Acht lassen (auch falsch angesetzte Nutzungsdauer)
- Fehlendes Schadenmanagement
- Fehlende Prozessbetrachtung, z.B. bei Rückgabe von Fahrzeugen
- Fehlende Spielregeln für Fahrzeugnutzer:innen (Umgang mit Fahrzeugen macht immer wieder Sorgen. Regeln
- Fehlendes Nachhaltigkeitsbewusstsein (Kosten für Verbrenner werden deutlich steigen… Spritpreiskurve?!)
- Fehlende Strategie zur Entwicklung der betrieblichen Mobilität (->weniger Mobilität kann mehr sein, Budgets, usw.)
- Ignorieren sinnvoller Digitalisierungsmöglichkeiten

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement 02/2022

(Marc-Oliver Prinzing, Zeitschrift Flottenmanagement 07/2021)
Die Pandemie hat nach 1 ½ Jahren deutliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, auf unser Miteinander und auf das „Dienst“-Reise- und Mobilitätsverhalten. Manche Themen wurden befeuert und hochgespült wie Homeoffice und digitale Meeting-Formate. Manche – wie die Klima-Diskussion – sind durch die Omnipräsenz der Virologen zwar nicht vergessen worden, aber eher in den Hintergrund geraten. Aber sind das alles Modeerscheinungen? Wird es in der Nach-Pandemiezeit alles wieder zu den alten Zuständen zurückkehren? Ich denke, nein.
Klar ist, dass die meisten Unternehmen noch stärker als zuvor auf Effizienz, Kostenreduktion und Flexibilität achten müssen. Das ökonomische und ökologische Aspekte zu beachten sind und intelligent gemanagt werden müssen, weiß jeder BWL-Studierender. Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein Trend und Umweltaspekte sind für Fuhrparkbetreiber entscheidungsrelevant. Die Auseinandersetzung mit alternativen Antriebsarten steht schon länger auf der Tagesordnung.
Die Sondersituation mit Covid-19 hat einigen Unternehmen die Chance gegeben, Mobilität neu zu denken. Das war lange überfällig. Nun sind nicht unbedingt neue, aber andere Möglichkeiten Mobilität zu organisieren, stärker in den Fokus gerückt – so auch das Mobilitätsbudget. Dabei besteht auch diese Idee schon seit längerem, gewinnt aber erst jetzt in Deutschland an Bedeutung. Ist das nur eine überkomplexe Pandemie-Mode, fragte der Management-Professor Stephan A. Jansen neulich in dem Fuhrparkverband-Online-Format „Ladezone – Talk & Impulse“. Oder ist es eine echte Ergänzung oder gar Alternative zum allseits beliebten Dienstwagen?
Mobilitätsbudget ermöglicht einen Optionenmix
Das Mobilitätsbudget sieht so aus: Mitarbeiter:innen von Unternehmen bekommen einen festgesetzten Geldbetrag zur Verfügung gestellt, der frei für die Mobilität genutzt werden kann. Dabei ist eine Aufteilung des Budgets auf verschiedene Transportmittel möglich – sei es für einen Dienstwagen, die ÖPNV, Carsharing, Leihräder oder einen Mietwagen. Durch den Mobilitätsmix kann das Reiseverhalten beliebig auf die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Vorteile für die Arbeitnehmer:innen liegen ganz klar auf der Hand. Mobilitätsbudgets sind insbesondere auch für Personen ohne Führerschein interessant oder bei denen der Wohnort in einer Innenstadt mit schlechter Parksituation liegt. Ein festgesetzter Betrag, der für verschiedene Transportmittel zur Verfügung steht, bietet außerdem Flexibilität und Spontaneität. Insbesondere für viele junge Mitarbeiter:innen – die Millennials oder auch Generation Y – ist der Mobilitätsmix interessant, stehen sie doch auf Freiheitsliebe und Flexibilität. Und diese Gruppe macht immerhin ein Fünftel aller Arbeitnehmer:innen in Deutschland aus.
Mobilitätsbudgets können aber auch maßgeblich zu einem verbesserten Betriebsklima und zur Gleichberechtigung beitragen. Während Dienstwagen meist nur Führungskräften, leitenden Angestellten oder Vertriebsmitarbeiter:innen zur Verfügung stehen, können im Rahmen eines kleineren monatlichen Fixbetrages auch Mitarbeitende davon profitieren, die bislang keine Dienstwagenberechtigung hatten. Je nach Unternehmen gibt es sogar eine Auszahlung des nicht genutzten Budgets beziehungsweise Zuschüsse zu Kita-Plätzen, zusätzliche Urlaubstage oder andere Prämien.
Zusätzlich zu den Arbeitnehmervorteilen profitieren selbstverständlich auch die Unternehmen von der Einführung der Mobilitätsbudgets. Dabei stehen insbesondere Nachhaltigkeitsaspekte im Fokus wie die Reduzierung der CO2-Emissionen. Das wirkt sich nicht nur positiv auf das Image aus, sondern auch auf die Mitarbeiter:innen. Gerade im Kampf um neue Angestellte können Aspekte der Nachhaltigkeit für die Arbeitsplatzwahl entscheidend sein. Unternehmen mit Flotten können außerdem Einsparungen bei den Fahrzeugen und Fuhrparkkosten erzielen.
Herausforderungen für Unternehmen
Neben den Vorteilen entstehen aber auch eine Reihe von Herausforderungen bei der Einführung von Mobilitätsbudgets, die im Vorfeld zu beachten sind. Gerade bei Unternehmen, die in ländlichen Gegenden angesiedelt sind, ist die Anbindung an den ÖPNV oftmals dürftig, was sich negativ auf die Mobilitätsoptionen auswirkt. Mobilitätsbudgets bieten dann für Mitarbeiter:innen keinen Anreiz und die Bereitschaft zur Änderung der Gewohnheiten sinkt. Hinzu kommt, dass Dienstwagen oftmals auch privat für beispielsweise Familienfahrten genutzt werden. In dem Fall sind Mitarbeiter:innen noch weniger bereit auf andere Mobilitätsarten umzusteigen. Für Nutzer:innen bedeutet das einen wesentlich höheren Planungsaufwand verbunden mit einer großen Eigenverantwortung, die viele nicht zu tragen bereit sind. Hier gilt es im Vorfeld gute Kommunikationsarbeit zu leisten, um die positiven Auswirkungen herauszustellen. Aber auch für Fuhrparkverantwortliche ergibt sich ein hoher administrativer Aufwand im Hinblick auf steuerliche Aspekte, die Verwaltung und neue Systeme für das Controlling. Mobilitätsbudgets verlangen die Ausweitung des Aufgabenbereichs auf die betriebliche Mobilität als Ganzes. Auch die steuerliche Betrachtung ist nicht ganz einfach. Anders als Dienstwagen wird das Mobilitätsbudget ganz normal versteuert. Dahingehend muss erst eine Lösung gefunden werden, weshalb Unternehmen immer noch sehr auf Dienstwagen fokussiert sind. Es zeigt sich aber ein Umdenken, was allerdings nicht von heute auf morgen umzusetzen ist.
Dienstwagennutzung wird unattraktiver
Bisher lagen motivierende Anreize für die Belegschaft oft bei einem guten Gehalt und einem leistungsstarken Dienstwagen. Dazu kommt aber immer mehr auch eine veränderte Haltung und eine Sensibilisierung, ökologisch verantwortungsvoll zu handeln. Jansen spricht von „Mobilitätsvermeidung als Mitarbeiterbedürfnis“. Ein Dienstwagen reicht also nicht mehr aus. Ganz im Gegenteil – manche sind nur mit individuellen Mobilitätslösungen zu beeindrucken. Aus diesen Gründen verzichten einige Mitarbeitende freiwillig auf ein Auto und der Dienstwagen gilt dann vielleicht nicht mehr als erstrebenswerter Vergütungsbestandteil. Wirft man einen Blick auf die Neuzulassungsstatistik zeigt sich allerdings, dass die Zulassungszahlen steigen. Gleichzeitig wird aber auch weniger gefahren, was im direkten Zusammenhang mit der Pandemie und dem damit einhergehenden veränderten Mobilitätsverhalten steht. Auch wenn Mobilitätsbudgets immer größeres Interesse gewinnen, hat der Dienstwagen noch nicht ausgedient, da die Mobilitätsoptionen vielerorts noch nicht ausreichend ausgebaut sind.
Zukunftsaussichten
Direkt zugeordnete Dienstwagen werden noch lange nicht verschwinden. Einige Branchen sind darauf angewiesen oder Mobilitätsbudgets machen (noch) keinen Sinn. Man kann vielmehr von einer friedlichen Koexistenz zwischen Dienstwagen und Mobilitätsbudget sprechen. In jedem Fall bedeuten Mobilitätsbudgets eine Veränderung des klassischen Fuhrparks im Hinblick auf Größe und Zusammensetzung der Flotte, aber auch in Bezug auf die Kosten- und Verwaltungsstruktur. Wie bei allen Aspekten der Nachhaltigkeit entscheidet auch hier die individuelle Situation und die Mobilitätsanforderungen eines Unternehmens, ob die Umsetzung eines Mobilitätsbudgets überhaupt Sinn macht. In jedem Fall sollten Mobilitätsbudgets in Zukunft auch im Blick behalten werden, denn es wird und muss sich noch einiges ändern. Eins ist aber klar: Mobilitätsbudgets sind bei richtiger Anwendung effizient, flexibel, klimaschonend und entsprechen in vielerlei Hinsicht dem neuen alltäglichen Mobilitätsverhalten vieler Menschen.
Weitere Informationen: www.mobilitaetsverband.de

Autor: Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Marc-Oliver Prinzing gilt als einer der führenden Experten für Fuhrparkthemen. Der Diplom-Betriebswirt und Leasingfachwirt hat jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Aufgabenbereichen rund um das Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent im Rahmen des berufsbegleitenden Ausbildungsgangs zum zertifizierten Fuhrparkmanager bei der DEKRA Akademie und nimmt einen Lehrauftrag für Flottenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr.
Seit Oktober 2010 ist er Vorstandsvorsitzender des Bund Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.). Kernaufgabe des Verbandes ist, die fachlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Belange und Interessen der Mitglieder zu vertreten. Der Verband fördert den Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder und bietet unterstützendes Know-how für das Fuhrparkmanagement an.
Veröffentlicht: Fachmagazin Nachhaltige Industrie Ausgabe 07/2022

(Axel Schäfer, Zeitschrift Flottenmanagement 09/2021)
Ist die Krise vorbei – oder kommt da noch was? Sicher ist und kann sich da noch niemand sein. Selbst Chefvirologen sprechen im Konjunktiv. Nach dem Ausnahmezustand kehrt doch zunehmend etwas Normalität ein. Doch in den letzten 18 Monaten wurde deutlich, welche Baustellen die Fuhrparkbranche hat und wie zukunftsfähig Unternehmen und das jeweilige Mobilitätsmanagement sind. Die Pandemie hat manche Entwicklungen beschleunigt und andere aus dem Scheinwerferlicht verdrängt.
Die meisten Unternehmen waren keine Krisengewinner. Ausnahmslos alle mussten sich in irgendeiner Form anders verhalten, anpassen, umplanen. Was jetzt jeden umtreibt: Wie geht es weiter – wie wird das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement nach der Krise aussehen? Vieles ist derzeit im Umbruch. Ob Mobilitätswende, zunehmende Anforderungen an Flottenverantwortliche oder Digitalisierung – das Fuhrparkmanagement ändert sich nicht ausnahmslos wegen, sondern auch trotz der Krise. Die Zeiten der liebgewonnenen Routinen in der betrieblichen Mobilität sind vorbei. Ein „weiter so“ wird es nicht geben. Statt dem Vergangenen wehmütig nachzutrauern, sollte man die unerwartete Chance nutzen, um einschlägige Themen endlich anzugehen.
Mobilität ist (lebens-)wichtig
Ohne Mobilität geht es nicht. Mobilität ist das Wasser auf dem Mühlrad und bringt alles ins Laufen. Aber Wasser und Mobilität sind wertvolle Güter und dürfen nicht verschwendet werden. Es ist dringend an der Zeit, ganzheitlich und so nachhaltig wie möglich zu denken. Wer dabei nur auf die Flotte sieht, der übersieht etwas. Die Coronakrise hat viele Unternehmen dazu gezwungen, flexibler zu werden. Ganz abgesehen davon, es zeichnen sich langfristige Änderungen des persönlichen Mobilitätsverhalten aufgrund der Corona-Krise ab. Keine Mobilitätsrevolution, wie das Fraunhofer Institut herausgefunden hat. Aber Verschiebungen. In den Großstädten mehr, als in ländlichen Gebieten. Der ÖPNV gehört dabei eher zu den Verlierern, der Individualverkehr und das Automobil zu den Gewinnern. Zu den betrieblichen und ökonomischen Anforderungen kommen in Zukunft ökologische und soziale Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und das bedeutet: Expertise für betriebliche Mobilität ist mehr denn je gefragt.
Durch ein auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abgestimmtes Mobilitätsmanagement können sich Unternehmen für die Mobilitätswende wappnen und diese aktiv mitgestalten. Fuhrparkverantwortliche müssen das große Ganze sehen und sich zu ressort- und abteilungsübergreifende Mobilitätsverantwortlichen wandeln. Es geht schließlich um das Mobilitätsmanagement der Zukunft. Es gilt, innovative Mobilitätsformen und -lösungen in eine „Mobility-Policy“ zu integrieren. Auf die Beschäftigten kommen dabei komplexe Aufgaben und viel Verantwortung zu. Es kommt nicht mehr nur darauf an, dass die Angestellten von A nach B gelangen. Es stellt sich zunehmend auch die Frage, wie genau sich die Fortbewegung gestaltet und ob sie überhaupt notwendig ist. Denn die Einschränkungen der letzten Monate haben gezeigt: Es geht auch anders. So manche Dienstreise, die bisher als unabdingbar galt, fand quasi über Nacht Ersatz durch die digitalen Möglichkeiten. Und das wird zu großen Teilen bleiben, denn es ist offensichtlich nicht immer nötig, spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.
Aufbruch in neue Zeiten
Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen durch die eingeleitete Dekarbonisierung und die Digitalisierung. Doch auch eine Mobilitätswende kann kein radikaler Umbruch sein, sondern ist ein Prozess der Übergangstechnologien, intelligente Lösungen und die richtigen politischen Rahmenbedingungen braucht. Umweltbewusste Fortbewegung ist heutzutage stärker gefragt als das klassische Ein-Mann-ein-Auto-Modell. On-Demand-Lösungen und Mobilitätsbudgets werden zunehmend attraktiv. Fuhrparks nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Gleichzeitig müssen die verantwortlichen Politiker:innen einen Masterplan für den Mobilitätswandel entwickeln. Dieser sollte ein Mobilitätsgesetz beinhalten, in dem regulatorische Rahmenbedingungen für die betriebliche Mobilität geschaffen werden. Bei den Herausforderungen unterstützt der Fuhrparkverband mit seiner Expertise. Zum Beispiel mit einer international nutzbaren Nachhaltigkeitszertifizierung in Zusammenarbeit mit der Fleet And Mobility Management Federation Europa (FMFE).
Zudem wird die Liste der modernen Fortbewegungsalternativen immer länger. Da die eine Universalalternative noch nicht gefunden ist, sollte man offen sein für alle Alternativen und nichts vorschnell verteufeln. Die Förderung der Elektromobilität ist grundsätzlich gut, Plug-in-Hybride aber eher eine Mogelpackung. Da ist unsere Position klar: Staatliche Unterstützung sollte an eine adäquate Stromnutzung von mindestens 50 Prozent gebunden sein. Die Ladeinfrastruktur wird weiter mit Bundesprogrammen gefördert. Beim eigentlichen Ladevorgang herrscht aber nach wie vor Chaos: In Deutschland gibt es derzeit knapp 300 Tarife für Autostrom mit einer Vielzahl von Identifizierungs- und Zahlungsmitteln. Die Zahlungssysteme variieren je nach Anbieter und können schnell zur Kostenfalle werden. Dienstwagen werden oft quer durchs Land genutzt, was das Laden zu einer echten Herausforderung macht – von Reisen ins Ausland ganz zu schweigen. Die Administration eines Fuhrparks wird dadurch unnötig erschwert. Außerdem sind die Einführung und das Management von Elektrofahrzeugen in Fahrzeugflotten alles andere als banal. Von Technik- und Personalfragen, Anpassungsbedarf bei der CarPolicy und Nutzungsüberlassungsverträgen bis hin zu Fördermöglichkeiten gibt es vieles zu beachten. Der Fuhrparkverband unterstützt und bietet mit seinem qualifizierten Kurs „Fleetricity“ die volle Ladung Know-how für Elektromobilität im Fuhrpark.
Digital ohne Empfang
Neue Antriebstechnologien und Mobilitätsformen sind nicht die einzigen Faktoren, die in den kommenden Jahren für eine Transformation der Flotte sorgen werden. Ein mindestens genauso starker Treiber ist die Digitalisierung. Die letzten Monate haben gezeigt: Das Fuhrparkmanagement ist zwar eingeschränkt, findet dank moderner Kommunikation und Technik aber weiterhin recht umfassend statt. Eine große Hürde ist allerdings die digitale Infrastruktur in Deutschland. Denn eine Digitalisierung ohne Internet, ohne Empfang ist schwierig. Gerade ländliche Regionen müssen kämpfen.
Künftig geht es darum, Dienstwege zu verkürzen, Arbeitsabläufe zu optimieren, Ressourcen zu schonen und unnötige Kosten einzusparen. Entsprechend geringer werden die Fahrleistungen sei, entsprechend kleiner können die Fuhrparks ausfallen. Je komplexer die Angelegenheit, desto wichtiger ist ein Treffen vor Ort. Alles andere geht auch digital.
Komplexe Themen kann man in den Griff bekommen. Der Wandel bringt faszinierende Möglichkeiten mit sich, man muss aber dafür offen sein. Mobilität ist und bleibt wichtig – die Frage ist nur, in welcher Form. Insgesamt gilt für den Mobilitätswandel: Das alles kann nur funktionieren, wenn die Verantwortlichen im Unternehmen das wirklich wollen und Mitarbeiter:innen einbezogen werden. Ich bleibe dabei und das wird beim Wandel helfen: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Worauf wir uns einstellen müssen
- Wer nur auf die Flotte sieht, der übersieht etwas
- Das Mobilitätsverhalten – privat und geschäftlich – ändert sich
- Die Menschen – auch unsere Kunden – wollen und drängen zu mehr Nachhaltigkeit
- Zu den betrieblichen und ökonomischen Anforderungen kommen in Zukunft verstärkt ökologische und soziale Aspekte
- Wirksame Alternativen – egal ob Antriebe oder Mobilitätskonzepte – müssen her
- Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement 09/2021
Nachhaltigkeit
(Axel Schäfer, Artikel für die Zeitschrift Flottenmanagement - Ausgabe Juni 2022)
Die Covid-Krise erzwang eine reduzierte Mobilität. Und aktuelle Probleme erfordern Flexibilität von Unternehmen in vielen Bereichen. Der Firmenfuhrpark bleibt das mobile Herz vieler Betriebe, doch Mobilität wird und muss weitergedacht und ganzheitlich betrachtet werden. Zukünftig müssen Mobilitätsmanager:innen alle vom Unternehmen ausgehenden beziehungsweise initiierten Verkehrsströme betrachten. Und vor allem darauf achten, eine effiziente, wirtschaftliche und umweltverträgliches Mobilität zu erreichen.

Mobilitätsmanagement bedeutet, die integrierten Mobilitätsanforderungen eines Unternehmens strategisch zu planen und flexibel zu steuern. Prinzipiell geht es dabei um die gesamte Unternehmensmobilität. Eingeschränkt auf den Teil der betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität sind neue Themen und Aspekte auf der Agenda, wie zum Beispiel Mobilitätsbudgets, neue Mobilitätskonzepte, Arbeitswege und das Travelmanagement. Es geht um jegliche durch Mitarbeiter ausgelöste Mobilität – und um die private Mobilität, da Unternehmen hier gefordert sind attraktive Lösungen bereitzustellen.
Die enge Verzahnung von Fuhrpark- und Travelmanagement ist mehr und mehr erforderlich und bei einem integrierten Gesamtkonzept zu betrachten. Beide Bereiche vereinen Ziele wie Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Kostentransparenz, Motivation und Sicherheit. Mittlerweile bietet sich Unternehmen im Hinblick auf das Mobilitätsmanagement der Mitarbeiter:innen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Von Diensträdern über Jobtickets und Homeoffice bis Dienstwagen als Teamfahrzeug ist nahezu alles möglich.
Eine zentrale Aufgabenstellung ist für das Mobilitätsmanagement zu klären, welcher tatsächliche Mobilitätsbedarf gegeben ist. Zwischen Bedarf und Bedürfnissen einzelner bestehen himmelweite Unterschiede. Nicht zu vergessen: Die Ausrichtung der Mobilität sollte auch die Frage des Verzichts auf Mobilität kritisch einbinden. Nicht alle Wege sind erforderlich. Eingesparte Kilometer haben eben auch eine sehr nachhaltige Wirkung.
Viele Dinge müssen heute auf den Prüfstand. Hierzu gehört die Dimensionierung und Art der Mobilitätsmittel genauso wie die Frage der Nutzungsdauer und -arten. Sprich: Muss ein Wechsel von Fahrzeugen wirklich im Drei-Jahres-Rhythmus erfolgen, wie in vielen Fällen gewohnt? Kann durch eine Reduzierung der Wegstrecken nicht auch die Nutzungsdauer verändert werden? Reine Elektrofahrzeuge sind länger sinnvoll nutzbar, zumal bei längerer Nutzung Nachhaltigkeitseffekte eintreten, Stichwort: Gesamt-CO2-Bilanz. Es gibt viele Fragen, die wir in der Zukunft beantworten sollten. Die Frage nachdem „wie“ wird dabei sicher differenzierte Antworten erfordern.
Mobilitätsmanagement im Fokus
Dass das Mobilitätsmanagement eine zentrale Rolle in Unternehmen und deren Fuhrparks einnimmt, hat der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. schon länger erkannt und sich schon lange um mehr als nur Fuhrparkthemen gekümmert. Der Vorstand hat intensiv an einer Neupositionierung gearbeitet, um die schon gelebten inhaltlichen Schwerpunkte und die veränderte strategische Ausrichtung auch nach außen zu tragen. Mit der Neuausrichtung geht nun auch eine Umbenennung des Verbandes einher: der Fuhrparkverband wird zum Mobilitätsverband und trägt von nun an den Namen Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM). Inhaltlich kümmert sich der Verband schon seit vielen Jahren um alle Themen der betrieblichen Mobilität. Die Änderung des Namens ist eine konsequente Entscheidung, die die Neuausrichtung des Verbandes für die Zukunft unterstreicht. Auch wenn der Fuhrpark weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, geht es zusätzlich um die Gestaltung einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen betrieblichen Mobilität in jeglicher Form. Mit der Neupositionierung werden sich die Aufgaben des Verbandes aber nicht ändern. Auch weiterhin behält der BBM alle Themen rund um den Fuhrpark im Blick und setzt sich für die Belange der Mitglieder auf allen Ebenen ein. Eine wesentliche Aufgabe besteht neben der Unterstützung mit Know-how darin, bei politischen Belangen die Stimme der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche zu bilden, um Veränderungen anzustoßen und mitzugestalten.
Sich mehr mit der Mobilität im Unternehmen auseinanderzusetzen ist unumgänglich. Ein gutes und durchdachtes Mobilitätsmanagement ist nicht nur zeitgemäß, sondern bringt Unternehmen viele Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Im Hinblick auf die Mitarbeiter:innen reduzieren sich die Mobilitätskosten für den Arbeitsweg und je nach Mobilitätsmittel verbessern sich die Fitness und Gesundheit, Motivation und Zufriedenheit. Gleichzeitig kann das Unfallrisiko reduziert werden. Unternehmen können vor allem von geringeren betrieblichen Mobilitätskosten und auch von einer Verringerung des Stellplatzbedarfs profitieren. Das bedeutet gleichzeitig eine Einsparung der Kosten für Bau, Anmietung und Unterhalt von Stellplätzen. Da für viele Mitarbeiter:innen ein angemessener Mobilitätsmix und eine Auswahl von Mobilitätsmöglichkeiten bei der Arbeitsplatzsuche zum Standard gehört, erhalten Unternehmen mit einem geeigneten Mobilitätsmanagement bessere Chancen bei der Suche nach Fachkräften. Gleichzeitig verbessert sich das Firmenimage. Mit der Umstellung der Mobilität im Unternehmen kann man zusätzlich einen positiven Nebeneffekt für die Umwelt erzielen und zur Mobilitätswende beitragen. Durch eine Verringerung der Mobilität mit dem Pkw reduzieren sich beispielsweise die verkehrsbedingten Umwelt- und Klimaeinflüsse und der Verbrauch fossiler Energieträger.
Angemessene Planung ist das A und O
Um ein angemessenes Mobilitätsmanagement im Unternehmen zu etablieren, ist eine genaue Planung und Analyse des Bedarfs nötig. In einem ersten Schritt sollte immer die Analyse des Ist-Zustands angesiedelt sein. Dazu gehört eine Bestandsaufnahme der jetzigen Mobilität im Unternehmen, um später entscheiden zu können, welche Maßnahmen und Mobilitätsmittel benötigt werden. Zudem sind Fragen wichtig wie „Wie viele Beschäftigte benutzen welches Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit? Wie viele Stellplätze gibt es auf dem Verkehrsgelände? Wie ist deren Auslastung? Wie ist die Erreichbarkeit des Standortes mit verschiedenen Verkehrsmitteln?“. Im Hinblick auf die ökologische Verantwortung eines Unternehmens sollte außerdem geprüft werden, ob Dienstwagen durch Pkw mit alternativen Antrieben ersetzt werden können beziehungsweise ob Dienstwagen überhaupt noch benötigt werden.
Um den genauen Mobilitätsbedarf abzudecken ist es ratsam, mit den Mitarbeiter:innen ins Gespräch zu gehen. Es ist sowieso sinnvoll, von Anfang an offen in der Kommunikation hinsichtlich der Veränderungen im Mobilitätsmanagement zu sein, um Akzeptanz zu schaffen. Veränderungen werden häufig nur ungern angenommen. Wenn der Sinn dahinter bekannt ist, fällt es allerdings leichter. Nach der konkreten Analyse sollte sich die Konzeption des Projektes anschließen, in der Ziele formuliert und konkretisiert werden. Darauf aufbauend können Maßnahmen entwickelt werden, die nötig sind, um die Ziele zu erreichen. Ist die Planung abgeschlossen, dann geht es an die Umsetzung. Bei der Umsetzungsphase ist es wichtig zu überprüfen, wie die Maßnahmen ankommen und ob alles so funktioniert, wie geplant. Anschließend folgen Überprüfung und Verstetigung, sofern die Maßnahmen gelungen sind. Ansonsten muss eine Anpassung stattfinden. Es ist in jedem Fall wichtig, das Mobilitätskonzept an die Bedürfnisse des Unternehmens und der Mitarbeiter:innen anzupassen. Denn Mobilitätsmanagement kann nur funktionieren, wenn die verantwortlich handelnden Mitarbeiter:innen das wirklich wollen.

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz ist Mobilitäts-, Fuhrparkmanagement und Leasing. Er publiziert zu den Themen regelmäßig Beiträge in Büchern, Fachmagazinen und ist immer wieder Redner bei Vorträgen im Rahmen verschiedener Events, Seminare und Workshops.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement (Ausgabe Juni 2022)
(Axel Schäfer, Artikel für die Zeitschrift Flottenmanagement - Ausgabe August 2022)
Für viele Unternehmen ist ökologisches Wirtschaften und nachhaltiges Handeln schon jetzt eine Selbstverständlichkeit. Der Fuhrpark wird nach den besten Möglichkeiten umweltbewusst ausgelegt. Mit der Erweiterung der CSR-Richtlinie müssen sich die Verantwortlichen in den Unternehmen künftig noch stärker damit auseinandersetzen. Ab 2024 sind viele Unternehmen dazu verpflichtet, die ausgestoßenen Emissionen nachzuweisen. Das hat auch Auswirkungen auf das Fuhrparkmanagement.
Die Corporate Social Responsibility, oder auch CSR, bezeichnet die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung und umschreibt den Beitrag von Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung. CSR hat eine ökologische, ökonomische und soziale Dimension. Im Idealfall greifen diese ineinander. Damit Unternehmen diese soziale und ökonomische Verantwortung nicht nur auf einer freiwilligen Basis ausführen, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, bestehen sogenannte CSR-Berichtspflichten. Diese wurden bereits 2014 durch das europäische Parlament und die Mitgliedstaaten der EU in der sogenannten CSR-Richtlinie verabschiedet. Ziel ist es, die Transparenz über ökologische und soziale Aspekte von Unternehmen zu erhöhen. In den CSR-Berichten geht es um Informationen zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, aber auch die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung spielen eine Rolle. Bisher war die CSR-Berichtspflicht für viele Unternehmen noch kein Thema, ab dem 1. Januar 2024 soll sich das allerdings ändern. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) soll die Berichtspflicht ausgeweitet werden. Ab 2024 gilt sie für große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, unabhängig von ihrer Rechtsform. Ab 2026 werden dann auch kapitalmarktorientierte kleine und mittlere Unternehmen in die Pflicht genommen. Die neue Berichtspflicht soll rückwirkend für das Geschäftsjahr 2023 gelten. Derzeit sind rund 12.000 Unternehmen in der EU von der CSR-Berichtspflicht betroffen, durch die neue CSRD-Richtlinie werden es etwa 50.000 sein, davon rund 15.000 allein in Deutschland. Durch die neuen Änderungen sollen nicht nur mehr Informationen für Dritte gewährleistet sein, sondern auch der soziale und ökologische Anspruch der Unternehmen gestärkt werden.
Mit der neuen CSRD-Richtlinie ändern sich außerdem die verpflichtenden Inhalte der Nachhaltigkeitsberichte. Neben zukunftsgerichteten Nachhaltigkeitszielen und -fortschritten sind ebenso nicht-bilanzierte immaterielle Vermögenswerte, die Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die „Double Materiality“ erforderlich. Das bedeutet, dass sowohl mögliche Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf die eigene wirtschaftliche Lage dargelegt werden müssen als auch die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft.
Auswirkungen auf den Fuhrpark
Aufgrund der neuen Berichtspflichten ergeben sich auch neue Anforderungen an Fuhrparkmanager:innen. Die Flotte eines Unternehmens leistet bekanntlich einen großen Beitrag zum Ausstoß der CO2-Emissionen – hier wird häufig angesetzt, um die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu verbessern. Gleichzeitig wird auch die betriebliche Mitarbeitermobilität auf den Kopf gestellt, denn auch hier lässt sich viel hinsichtlich der Nachhaltigkeit verändern. Um das ökologische Verhalten von Unternehmen im CSR-Bericht zu verbessern, wird es langfristig um die Vermeidung und Senkung der Emissionen im Bereich der Mobilität gehen. Dann sind Mobilitäts- und Fuhrparkverantwortliche gefragt. Viele Firmen setzen auf eine Elektrifizierung der Flotte und damit verbunden auf den Bau einer Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort. Auf Fuhrparkverantwortliche kommt eine umfassende Planungsphase zu, die neben der Fragen nach den geeigneten Fahrzeugen auch die Frage nach den Lademöglichkeiten klären muss. Dazu muss zunächst der Bedarf ermittelt werden. Gleichzeitig müssen sich Fuhrparkmanager:innen im Rahmen der CSR-Berichtspflichten auch mit alternativen Mobilitätslösungen befassen. Nicht für alle Mitarbeitenden ist ein Elektroauto die richtige Wahl. Die individuelle betriebliche Mitarbeitermobilität ist in den Blick zu nehmen und auch Aspekte wie Mobilitätsbudgets oder Car Sharing sind einzubinden. Um die CO2-Emissionen zu verbessern, ist auch die Treibhausgasminderungsquote ein probates Mittel. Durch die Anschaffung von Elektrofahrzeugen kann die THG-Quote verkauft werden und Unternehmen erhalten zusätzliches Geld. Ganz gleich für welche Nachhaltigkeitslösungen sich Fuhrparkverantwortliche entscheiden, es wird notwendig sein, eine neue Car Policy aufzustellen und Regeln für Geschäftsreisen festzulegen. Nur durch ein ganzheitliches Konzept lassen sich Emissionen senken und der CSR-Bericht positiv beeinflussen.
Nachhaltigkeit und betriebliche Mitarbeitermobilität in den Fokus rücken
Da die Nachhaltigkeitsstrategie ein komplexes Thema ist, welches individuell auf den Fuhrpark abgestimmt werden muss, hat die Fleet and Mobility Management Federation Europe (FMFE) gemeinsam mit den sieben Landes-Mobilitätsverbänden Unterstützung geschaffen. In diesem Rahmen bietet der Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) die Europäische Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensmobilität (ECSM) an. Gemeinsam mit dem Verband können Unternehmen den Ist-Stand des Fuhrparks bestimmen und geeignete Maßnahmen für die Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln. Darüber hinaus ist es wichtig, sich mit der gesamten betrieblichen Mobilität auseinanderzusetzen. Diesem Thema widmet sich der BBM am 8. und 9. September in Hannover auf der Nationalen Konferenz für betriebliche Mobilität. Um Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche umfassend bei der Planung der betrieblichen Mitarbeitermobilität zu unterstützen, behandelt die Konferenz sämtliche Fragen des aktuellen und künftigen Mobilitätsmanagements.
Neben Aspekten wie der Digitalisierung, dem Travelmanagement und der Mikromobilität geht es vor allem um Nachhaltigkeit und die betriebliche Mitarbeitermobilität. Unternehmen sind mehr und mehr angehalten, nicht nur den Fuhrpark, sondern die Mobilität als Ganzes zu betrachten, um einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten und voranzukommen. Dazu gehört eine umfassende Auseinandersetzung mit der betrieblichen Mitarbeitermobilität. Diesem komplexen und weitreichenden Thema soll sich auf der Konferenz gewidmet werden. Das innovative Veranstaltungsformat richtet sich an Mobilitätsentscheider:innen aller Unternehmen. Die Konferenz bietet in Keynotes, Workshops oder Expertenpools hochkarätige Referent:innen. Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter https://www.nationale-konferenz-mobilitaet.de/.

Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz ist Mobilitäts-, Fuhrparkmanagement und Leasing. Er publiziert zu den Themen regelmäßig Beiträge in Büchern, Fachmagazinen und ist immer wieder Redner bei Vorträgen im Rahmen verschiedener Events, Seminare und Workshops.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement (Ausgabe August 2022)

(Axel Schäfer, Zeitschrift Flottenmanagement 12/2021)
Der Weg in Richtung Mobilitätswandel führt über nachhaltiges Handeln. Das ist in vielen Unternehmen ein Thema – und die spielen im Konzert der Akteure eine der wichtigsten Rollen, verantworten Sie doch die Mehrzahl der Fahrzeug-Neuzulassungen. Mit der Europäische Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensmobilität (ECSM für European Certification of Sustainable Mobility) ist ein großer Schritt getan.
Die ECSM ist als Investition in die Zukunft zu verstehen, die Unternehmen vielfältige Optionen bereitstellt. Eines ist klar – alle Unternehmen müssen sich auf den Weg machen, denn Nachhaltigkeit muss flächendeckend und ernsthaft umgesetzt werden. Nur dann erreichen wir etwas und nur so kann eine Mobilitätswende gelingen. Auch klar ist, dass nicht nur der automobile Fuhrpark, sondern die betriebliche Mobilität als Ganzes dabei einbezogen werden muss. Dazu brauchen wir keine Sonntagsreden – vor allem nicht von Politiker:innen oder Vorstandsvorsitzenden, die anschließend mit dem Privatjet zum Mittagessen nach Hause fliegen. Wir brauchen Vorbilder. Unternehmen, die voran gehen und zeigen, dass eine Unternehmensstrategie und ein ernsthafter Umsetzungswillen dahinter steckt. Keine Lippenbekenntnisse, um Shit-Storms zu vermeiden. Kein Greenwashing, keine Nebelkerzen und Corporate -Blabla, keine Augenwischerei. Unternehmen, die erkennen, dass es sich hier nicht um eine Nice-to-have-Aktion oder PR-Kampagne handelt, sondern um zukunftsweisende Entscheidungen, die wichtig sind für unsere Gesellschaft und erfolgskritisch für das Unternehmen. Die schonungslos auch eigene Schwächen akzeptieren, aufdecken und abstellen.
Erste Zertifizierung erfolgreich
Die Carglass GmbH ist nun das erste Unternehmen, das mit Hilfe der ECSM-Zertifizierung die betriebliche Mobilität langfristig verändern will. Ziel ist unter anderem die Reduzierung von CO2-Emissionen. Ein Ansatz hierzu soll das kundenfreundliche Angebot moderner Ersatzmobilität, die das Unternehmen seit 2021 in den 370 Service-Centern mit insgesamt 121 Elektrofahrzeugen auf die Straße bringt. Im Jahr 2022 sollen zahlreiche weitere Fahrzeuge durch E-Fahrzeuge ersetzt werden und rund 30 Prozent der hauseigenen Flotte bis 2025 mit alternativen Antrieben unterwegs sein. „Eine erste Zertifizierung durch den Bundesverband Fuhrparkmanagement erfolgte bereits 2019 mit einem Umweltaudit. Für uns war die ECSM Zertifizierung auf europäischer Ebene der logische nächste Schritt. Denn wir sind nach wie vor ambitioniert und möchten die Verbesserung der Unternehmensmobilität hin zu mehr Nachhaltigkeit fördern“, sagt Oliver Benz, Senior Experte Mobility Management & Sustainable Supply Chain Management der Carglass GmbH.
Hinzu kommt eine ganzheitliche Weiterentwicklung des Fuhrparks unter durchgängiger Berücksichtigung der Total Cost of Ownership (TCO) sowie die Digitalisierung der Fuhrparkprozesse. Hinsichtlich der Mitarbeitenden mit Firmenwagenanspruch soll die Nutzung alternativer Mobilitätskonzepte angeregt werden. Carglass hat das Angebot des Fuhrparkverbands genutzt und erfolgreich den ECSM-Zertifizierungsprozess durchlaufen. Damit ist das Unternehmen der erste Absolvent, der das europäische Zertifikat durch den Fuhrparkverband erhalten hat. Entwickelt mit den Mitgliedverbänden der Fleet and Mobility Management Federation Europe (FMFE) bietet die Zertifizierung eine Unterstützung für Unternehmen, die die Verbesserung der Mobilität hin zu mehr Nachhaltigkeit fördern möchten.
Handlungsempfehlungen und konkrete Maßnahmen
Die Zertifizierung unter Begleitung von Experten des Fuhrparkverbandes erfolgt in drei Schritten. Nach dem Auftrag zur Begleitung und zur Zertifizierung ist die Ist-Analyse angesiedelt, die den aktuellen Zustand eines Unternehmens beschreibt. Alle wichtigen Informationen zur Unternehmensmobilität werden gesammelt, die Ziele definiert und ein Verbesserungsprogramm erarbeitet. Handlungsfelder sind beispielsweise die betriebliche Mobilitätsstrategie. Mit der Einführung einer nachhaltigen Mobilitätspolitik, der globalen Messung der erzeugten Emissionen und der Förderung der alternativen Mobilität. Im Handlungsfeld Unternehmensflotte geht es um angemessene Flotten-Dimensionierung, der Suche nach Energieeffizienz und Ausbildungsprogrammen. Beim Thema Mitarbeitermobilität um die Änderung der Mobilitätsgewohnheiten, effizientere und sichere Mobilität. Und im Bereich der Kunden und Lieferanten geht es um die Parameter zur Nachhaltigkeit die gelebt und eingehalten werden. Die abschließende Implementierungsphase setzt die zuvor festgelegten Maßnahmen um. Danach ist der Zertifizierungsprozess aber nicht etwa abgeschlossen. Er sieht eine mehrjährige Betreuung und Kontrolle vor, der die langfristige Veränderung und Verbesserung des Unternehmens in vielerlei Hinsicht zum Ziel hat. In Abständen von einem Jahr werden in einem Evaluationsprozess die Maßnahmen überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Der ECSM-Ergebnisbericht zeigt den Unternehmen auf, was sie richtig machen und in welchen Punkten Verbesserungsbedarf besteht. „Die Auszeichnung ist für uns die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, viele Ziele schon erreicht haben, Emissionen reduzieren und Kosten einsparen konnten und bringt sowohl extern als auch intern sehr positive Resonanz. In den Bereichen Mobilitätsstrategie, Kunden und Lieferanten sowie unserem Fuhrpark konnten wir erneut eine durchgängig gute bis sehr gute Bewertung erreichen“, resümiert Benz. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass sich noch vieles auf dem Weg in die Nachhaltigkeit ändern kann. Benz dazu: „Im Bereich Pendlermobilität konnten wir im Rahmen der Zertifizierung noch Entwicklungspotenziale erkennen. Maßnahmen wie Fahrsicherheitstrainings, Ökofahrtrainings werden zukünftig weiter ausgerollt. Darüber hinaus werden wir Möglichkeiten für eine nachhaltige Pendlermobilität mit Fahrrädern, Pedelecs, ÖPNV; Fahrgemeinschaften etc. untersuchen, um zielgerichtete Optimierungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen.“
Schaffung eines europäischen Standards
ECSM bietet sich für Unternehmen auch vor allem aufgrund der internationalen Ausrichtung an. Durch das europäische Netzwerk der FMFE wurde ein internationaler Standard geschaffen, der dennoch die Besonderheiten der einzelnen Länder berücksichtigt. Durch die Nutzung einer einheitlichen Vorgehensweise können davon insbesondere europaweit agierende Unternehmen profitieren. Durch die Begleitung von Experten kann das Zertifikat als ein Prozess mit dem Ziel einer langfristigen Veränderung der Unternehmensmobilität betrachtet werden. „Wir verstehen die Zertifizierung nicht als Momentaufnahme, sondern als Ausgangspunkt für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Gemeinsam mit dem Fuhrparkverband werden wir in den kommenden vier Jahren weiter an zukunftsweisenden und flexiblen Mobilitätsmodellen arbeiten“, unterstreicht Benz. In Abstimmung mit dem Unternehmen werden die Maßnahmen regelmäßig überprüft und die Handlungsempfehlungen bei Bedarf angepasst. Das alles hat auch einen internen Effekt. Die Zertifizierung trifft in der Regel auf sehr positive interne Resonanz und ist zugleich Ansporn, das Thema weiter zu verfolgen, neue Ideen zu entwickeln und die Mobilität von morgen zu gestalten. Das hat Effekte auf die Motivation der Mitarbeitenden und auch auf die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Denn das Unternehmen zeigt soziale Verantwortung.
Wer für sein Unternehmen an diesem Weg gefallen finden könnte, der kann vom Know-how und Netzwerk des Fuhrparkverbands profitieren und weitere Infornationen erhalten und/oder gerne ein Informationsgespräch führen.



Autor: Axel Schäfer, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Axel Schäfer ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit gegründeten Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement Ausgabe 12/2021

(Marc-Oliver Prinzing, Zeitschrift Flottenmanagement 05/2021)
Nachhaltiges Wirtschaften gehört inzwischen nicht nur zum guten Ton, es ist für die meisten Unternehmen ein erfolgskritischer Teil der Unternehmensstrategie. Nicht nur der automobile Fuhrpark, die Mobilität als Ganzes ist dabei ein wichtiger Hebel. Durch die Corona-Pandemie ist das Thema nicht unwichtig geworden, auch wenn der Klimawandel weniger in den Schlagzeilen zu finden war.
Die gute Nachricht: Wir beobachten, dass viele Betriebe sich in den letzten Monaten intensiver mit dem Thema der nachhaltigen Mobilität auseinandergesetzt haben. Aufgrund von Home-Office und Online-Meetings wurde die Nachhaltigkeit außerdem dahingehend gefördert, dass Mobilität in vielen Fällen nicht stattfindet. Und die nachhaltigste Form der Mobilität ist immer die, die nicht vorhanden ist. Dort, wo darauf verzichtet werden kann, sollte es getan werden. Die notwendige betriebliche Mobilität ist zu optimieren, so dass ökologische und ökonomische Ziele erreicht werden können.
Betriebliche Mobilität nachhaltiger zu gestalten – dabei unterstützt der Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) mit einer Nachhaltigkeitszertifizierung. Die vom BVF mitgegründete Fleet and Mobility Management Federation Europe (FMFE), hat gemeinsam mit den sieben Landes-Mobilitätsverbänden einen Zertifizierungsprozess entwickelt, der ab sofort verfügbar ist: Die Europäische Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensmobilität (ECSM für European Certification Of Sustainable Mobility).
Nachhaltige Mobilität wird vorangetrieben
Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen, die die Verbesserung der Unternehmensmobilität hin zu mehr Nachhaltigkeit fördern und so einen Beitrag zu langfristigen ökologischen Verbesserungen unterstützen möchten. Wer die Ziele erreicht und Schadstoffemissionen reduziert, agiert nicht nur im Sinne unserer Umwelt. Das allein wäre schon ein wichtiger Anlass. Zusätzlich können Kosten eingespart werden.
Die Zertifizierung erfolgt in drei Schritten. Nach dem Auftrag zur Begleitung und Zertifizierung werden zunächst alle wesentlichen Informationen zur Unternehmensmobilität analysiert, Ziele definiert und ein Verbesserungsprogramm erarbeitet. Das Hauptaugenmerk der Bewertung liegt beispielsweise auf der Organisation der betrieblichen Mobilität, auf der eingesetzten Technik und der Nutzung alternativer Antriebe. Da jedes Unternehmen anders aufgestellt ist, findet die Bewertung individuell statt. Dazu kommt, dass nicht jeder alternative Antrieb auch automatisch umweltfreundlich ist. Falsch eingesetzt führen sie nicht nur zu erheblichen Mehrkosten gegenüber den fossilen Antrieben, sondern auch zu einer negativen Umweltbilanz. Auch mit herkömmlichen Antrieben kann die Umweltbilanz verbessert werden, etwa durch eine Reduktion des Kraftstoffverbrauchs.
In der Implementierungsphase werden die abgeleiteten Maßnahmen umgesetzt und nachverfolgt. Vier Jahre lang erfolgt eine jährliche Evaluation. Dabei werden die Ergebnisse mit den Zielen abgeglichen. Um veränderte Rahmenbedingungen, neue Technologien und Möglichkeiten in den Zertifizierungsprozess einzubinden, können nach der Überprüfung Ziele und Maßnahmen angepasst werden. Dieser Schritt ist aber auch dahingehend wichtig, um Erfolge und Veränderungen im Mobilitätsmanagement des Fuhrparks sichtbar zu machen.
Vorteile für Fuhrparkbetreiber
Einer der großen Vorteile der Zertifizierung liegt in der Verbesserung des Images sowohl nach innen als auch nach außen. Warum? Die soziale Verantwortung eines Unternehmens wird deutlich, indem die Nachhaltigkeitsziele transparent werden und mit konkreten und messbaren Maßnahmen unterlegt sind. Der Weg zu einem nachhaltigeren Mobilitätsmanagement wird fassbar. Das begeistert auch aktuelle und potenzielle Mitarbeitende und steigert die Zufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität. Aber nicht nur in Bezug auf die Wirkung können Fuhrparkbetreiber von der ECSM profitieren. Hinzu kommt außerdem eine Verbesserung der Mobilität, insbesondere durch alternative Mobilitätslösungen, sowie der Beitrag zur Emissionsminderung.
Durch das europäische Netzwerk der FMFE findet die ECSM wird ein international ausgerichteter Standard geschaffen, der die Besonderheiten der Länder berücksichtigt und zunächst in Deutschland und Spanien startet. Anbieter dieses Zertifikats werden im nächsten Schritt alle Mitglieder der FMFE sein, also Mobilitätsverbände aus Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Österreich und der Schweiz. Über das europäische Netzwerk der FMFE können Unternehmen in allen beteiligten Ländern eine einheitliche Vorgehensweise nutzen und müssen dennoch nicht auf die Berücksichtigung der länderspezifischen Besonderheiten verzichten. Insbesondere europaweit agierende Unternehmen profitieren von den länderübergreifend gültigen Standards. Aufgrund der Begleitung durch Experten kann das Zertifikat als ein Prozess mit dem Ziel einer langfristigen Veränderung und Verbesserung der Unternehmensmobilität gesehen werden. Die ECSM ist als Investition in die Zukunft zu verstehen, die Unternehmen vielfältige Optionen bereitstellt.
Übersicht Handlungsfelder
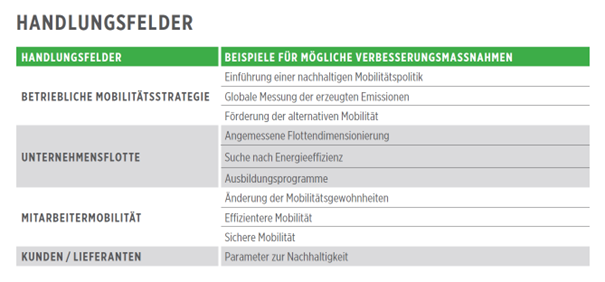


Autor: Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Marc-Oliver Prinzing gilt als einer der führenden Experten für Fuhrparkthemen. Der Diplom-Betriebswirt und Leasingfachwirt hat jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Aufgabenbereichen rund um das Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent im Rahmen des berufsbegleitenden Ausbildungsgangs zum zertifizierten Fuhrparkmanager bei der DEKRA Akademie und nimmt einen Lehrauftrag für Flottenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr.
Seit Oktober 2010 ist er Vorstandsvorsitzender des Bund Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.). Kernaufgabe des Verbandes ist, die fachlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Belange und Interessen der Mitglieder zu vertreten. Der Verband fördert den Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder und bietet unterstützendes Know-how für das Fuhrparkmanagement an.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement Ausgabe 05/2021
UVV

(Dieter Grün, Zeitschrift Flottenmanagement 11-12/2020)
Der Arbeitgeber ist verantwortlich dafür, dass den Angestellten sichere elektrische Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden. Das gilt auch für den Fuhrpark. Denn gerade Elektrofahrzeuge verfügen über empfindliche Technik mit besonderen Gefahren. Das betrifft sowohl die verbaute Elektronik als auch das Zubehör. Die elektrischen Anlagen inklusive der Ladekabel von Elektro- und Hybrid-Dienstfahrzeugen müssen daher selbstverständlich Gefährdungsbeurteilungen und regelmäßigen Prüfungen unterzogen werden. Viele Verantwortliche nehmen das Thema derzeit jedoch auf die leichte Schulter.
Wer Elektrofahrzeuge in seinen Fuhrpark integrieren möchte, der hat sich zuvor mit der Technik und der Kompatibilität mit den Nutzungsprofilen beschäftigt. Ist es dann soweit, hat das auch Auswirkungen auf die gesetzliche Unfallversicherung, die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und die Haftung von Arbeitgeber beziehungsweise verantwortlicher Person im Betrieb. Kein Wunder also, dass sich Fragen häufen, wie: Was muss beachtet werden, arbeitet man an Hochvoltsystemen, welche gesundheitlichen und fachlichen Voraussetzungen müssen die Beschäftigten mitbringen, müssen Schutzausrüstungen vorhanden sein und vieles mehr. Das sind nur einige der Punkte. Geklärt werden sollten auch Besonderheiten beim Umgang mit Pannen, Ladetechnik und Akkus. Für den regelkonformen Umgang im Fuhrparkmanagement zählt auch die Überprüfung von Ladekabeln der Elektrofahrzeuge und elektrischen Anlagen von Dienstfahrzeugen, die als Werkstattfahrzeuge mit eigener Stromerzeugung im Einsatz sind.
Kontrolle ist Pflicht
Grundsätzlich gilt: Das Überprüfen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel in bestimmten Zeitfenstern soll deren ordnungsgemäßen Zustand gewährleisten. Das erhöht nicht nur die Sicherheit der direkten Beteiligten, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmender. Durch derartige Kontrollen wird also der betriebliche Arbeitsschutz erheblich verbessert.
Fuhrparkfahrzeuge fallen in diesem Zusammenhang ebenfalls unter die Betriebssicherheitsverordnung. Entsprechend muss deren Beschaffenheit regelmäßig – mindestens jährlich – überprüft werden. Das besagt auch Vorschrift 70 „Fahrzeuge“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Davon betroffen sind die Gefährdungsbeurteilung sowie die eigentliche Fahrzeugprüfung. Für wiederkehrende Prüfungen sind vor allem Art, Fristen und Umfang festzulegen.
Durch eine verpflichtende Gefährdungsbeurteilung mit entsprechender rechtssicherer Dokumentation ist also zu ermitteln, ob sich die Arbeitsmittel – in diesem Fall also das E-Auto – in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Art und Umfang sowie eine befähigte Person müssen dafür festgelegt werden. Der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen durch befähigte Personen/Sachkundige“ gibt hilfreiche Hinweise für die Beurteilung des betriebssicheren Zustandes.
Der Umfang umfasst beispielsweise Sichtprüfung, Messen, Funktionsprüfung, Dokumentation inklusive Prüfprotokoll, Auswertung sowie Vereinbarung des nächsten Kontrolltermins. Messungen müssen mit geeigneten Geräten und Abläufen gemäß den vorgegebenen DIN VDE Vorschriften durchgeführt werden.
Beispielhaft sind folgende Regeln je nach Anwendungsfall einzuhalten: DIN VDE 0404 „Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten“, DIN EN 61557-1 „Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1.000V und DC 1.500V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen“ sowie DIN EN 610101 „Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte“. Für die Prüfungen selbst relevant sind DIN VDE 0701-0702 „Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte“, DIN VDE 0100600 „Errichten von Niederspannungsanlagen“, DIN VDE 0105100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ sowie „VDE 01131 „Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen“.
Sich mit diesen Themen zu beschäftigen gehört zur Aufgabe im Rahmen der betrieblichen Fahrzeugbereitstellung.
Ladekabel regelmäßig überprüfen
Ladekabel für Elektrofahrzeuge sind zum Beispiel Anschlusskabel Mode 3 mit zwei speziellen Steckern oder Mode 2 Ladekabel für die häusliche 230-V-Steckdose. Dieses Kabel beinhalteten Vorschalt-/Schutz- Elektronik. Für die Prüfung sind entsprechende Adapter erforderlich.
Die elektrische Sicherheit muss nach DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ geprüft werden. Diese Vorgabe ist eine der Kernaussage der FAQ-Liste der AG „Handlungsrahmen Elektromobilität der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV). Die Vorgehensweise, durch die sicherheitsrelevante Mängel erkannt werden sollen, ist in der DGUV Information 203-070 „Wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel – Fachwissen für Prüfpersonen“ ausführlich beschrieben. Es werden wertvolle Hinweise für die Organisation der wiederkehrenden Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel gegeben. Dabei wird neben einigen Grundlagen und den rechtlichen Vorgaben beispielsweise auch auf Aspekte wie Prüffristen, Dokumentation und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln eingegangen.
Dieses Werk baut auf die DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel – Organisation durch den Unternehmer“ auf, in der die rechtlichen Grundlagen und die Notwendigkeit der Prüfungen beschrieben sind. Es kann so gesehen als eine praktische Umsetzung der DGUV Information 203-071 verstanden werden. Ergänzende Hinweise lassen sich in VDE 0701/0702 zur sachgerechten Sicherheitsprüfung von Elektrogeräten finden.
Prüfung von Stromerzeugungsanlagen in Dienst-/ Werkstattfahrzeugen
Viele Firmenwagen verfügen über eigene, in sich selbst verbaute Generatoren, die eine Spannung von 230 Volt erreichen. Deshalb müssen diese Anlagen gewisse Schutzmechanismen vorweisen, gerade im Hinblick auf elektrische Gefährdung. Was vielen nicht klar zu sein scheint: Die Funktionalität des Schutzes muss natürlich nach entsprechenden Standards geprüft werden.
Der ordnungsgemäße Zustand einer elektrischen Anlage oder eines Betriebsmittels betrifft neben den Maßnahmen zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit auch alle Instrumente zum sicheren Betrieb. Dazu zählen etwa Einrichtungen zum Schutz gegen mechanische, hydraulische, optische oder andere Gefährdungen. Im Übrigen dürfen bei Überprüfung der Elektronik auch Aspekte wie Bordcomputer, Steckvorrichtungen oder Verteiler beziehungsweise Wandler nicht vergessen werden. Bei der Überprüfung ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel wird nach DIN VDE 0701-0702 verfahren. Bei der Errichtung von Niederspannungs-Stromerzeugungsanlagen, zum Beispiel bei fest verbauten Generatoren, ist die Normenreihe VDE 0100 zu beachten.
Weitere Hinweise lassen sich bei den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) finden. Zu nenne sind die TRBS 1111 „Gefährdungsbeurteilung/ Sicherheitstechnische Bewertung“ sowie die TRBS 1112 „Instandhaltung“. Empfehlenswert ist bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung auch die Gefahrstoffverordnung oder das Arbeitsschutzgesetz sofort zu beachten. Verantwortliche sollten sich darüber hinaus von Sachkundigen unterstützen lassen, wie beispielsweise Betriebsärzten, der verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) oder Experten für (Arbeits-)Sicherheit und Elektrofachkräften. Als Prüfkraft kommt gemäß TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Person“ infrage, wer über eine elektrotechnische Ausbildung verfügt sowie eine mindestens einjährige Berufserfahrung im elektrotechnischen Bereich vorweisen kann. Weitere Angaben zur befähigten Person lassen sich auch in §2 Betriebssicherheitsverordnung nachlesen.
Empfindliche Strafen
Die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen im Rahmen der UVV oder des gesetzlichen Arbeitsschutzes sollte niemand auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn es sich dabei durch einen Dschungel aus Vorschriften zu wühlen gilt, erhöht es letztendlich die Sicherheit sowohl im Betrieb als auch im Straßenverkehr. Kein Wunder also, dass bei Nichteinhaltung hohe Strafen drohen können. Und auch hier gilt wie so oft: Torheit schützt nicht.
Egal ob bewusst oder unbewusst gegen die Vorschriften verstoßen worden ist: Kommt es zu einem Unfall, muss die Firma möglicherweise nachweisen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten worden sind. Ist das nicht der Fall, können auf Arbeitgeber und Fuhrparkverantwortliche hohe Regressansprüche zukommen. Und das kann richtig teuer werden. Vor allem, wenn es sich um Fahrlässigkeit handelt und daraus Personenschäden entstanden sind. Zusätzlich sind im Sinne einer Ordnungswidrigkeit Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro möglich.

Sie wollen Elektromobilität einführen und managen? Dafür brauchen Sie einen umfassenden Überblick? Dann nutzen Sie das Angebot Fleetricity des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (www.fleetricity.de).

Autor: Dieter Grün, Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.
Dieter Grün ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) in Mannheim und Fuhrparkleiter in einem kommunalen Betrieb.
Veröffentlicht: Zeitschrift Flottenmanagement Ausgabe 11-12/2020
